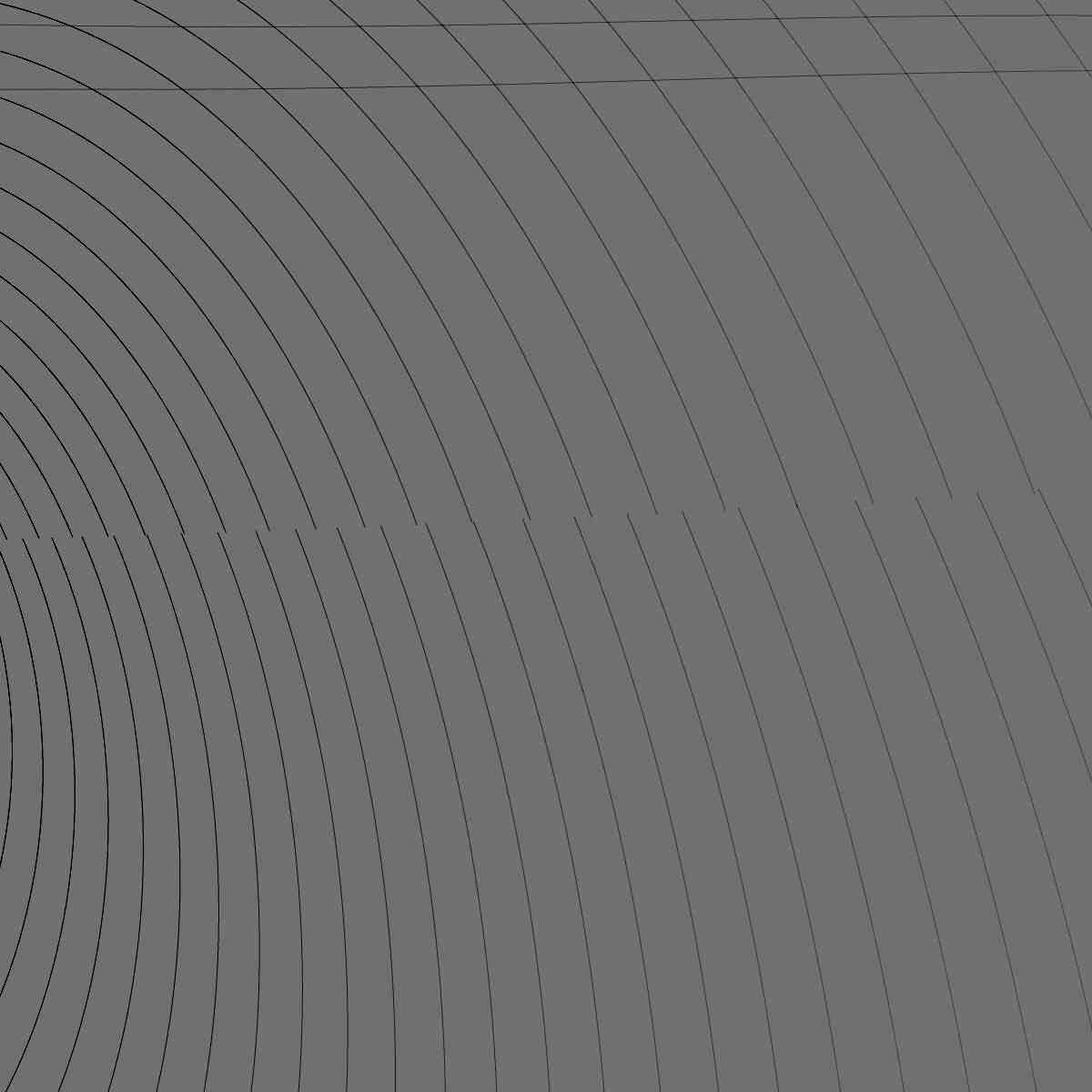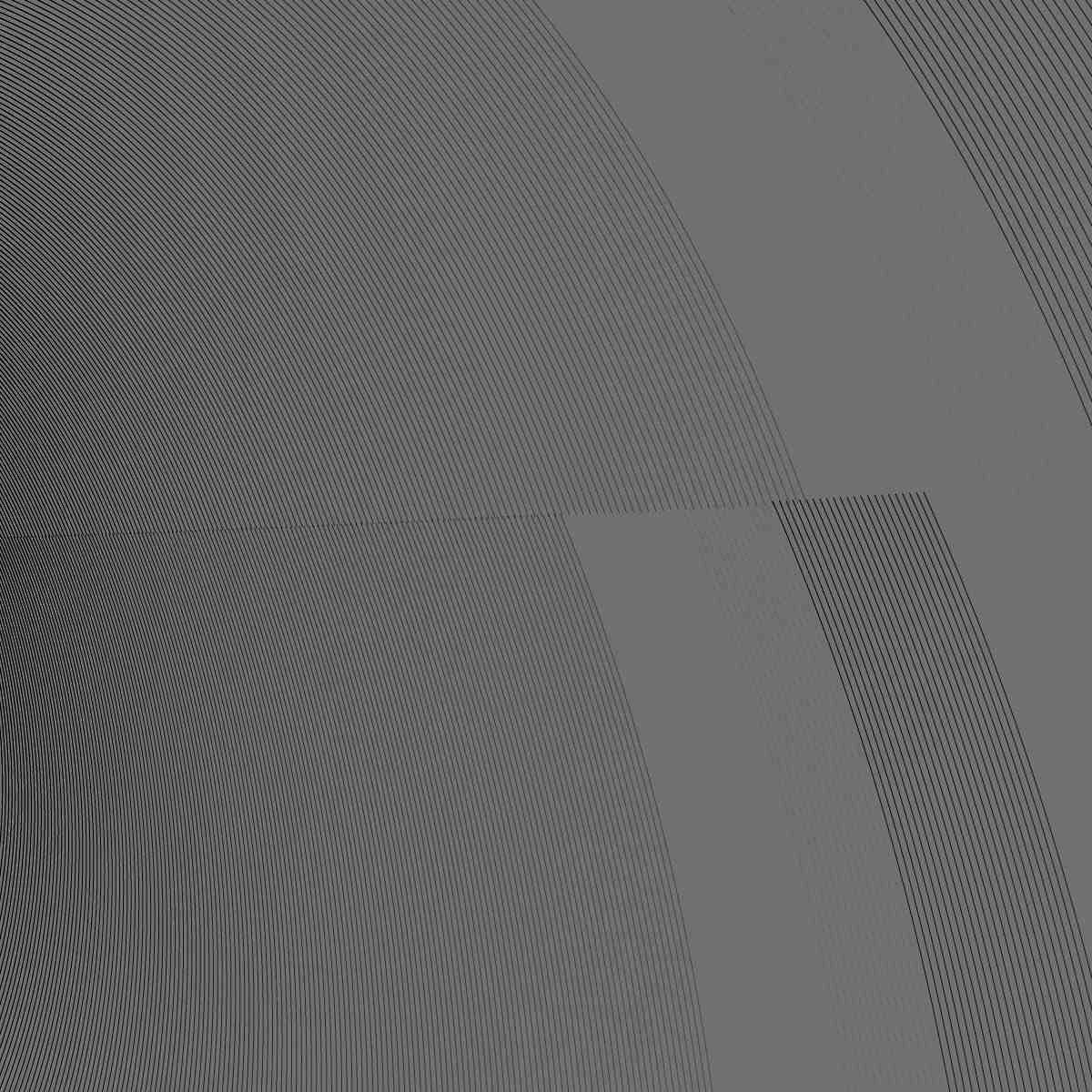Text Bianca Ludewig | Fotos Jürgen Grosse & Bianca Ludewig | Layout Georgee
„Die Leute wissen immer noch nicht, was der Unterschied ist zwischen Guerilla-Marketing und künstlerischem Ausdruck aus Eigenantrieb. Oder einfach: guter und schlechter Streetart.“

„Warum machen wir eigentlich noch Backjumps, wenn doch der Herausgeber der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘ und die Deutsche Bank, die ja Bilder von Banksy gekauft haben, schon zu uns gehören?“
Findet eine gesellschaftliche Auseinandersetzung auf symbolischer Ebene überhaupt noch statt?“, fragt jemand im Publikum bei einer Diskussionsrunde im Rahmen der Backjumps Live Issue #3. Gemeint ist hier der Bezug zu Baudrillard und seiner These der ökonomischen Nichtverwertbarkeit von Graffiti, denn sein in Frankreich 1968 erschienener Text „Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen“, der 1978 in deutscher Übersetzung erschien, steht bei diesem Talk im Vordergrund. Für manche Writer ist der Text Pflichtlektüre. Für Anhänger der Parole „Graffiti braucht kein Abitur“ bleibt er eine No-Go-Area. Binnen wenigen Minuten ist die Stimmung im Raum emotional total aufgeladen. Der Philosoph und Kunstkritiker Knut Ebeling findet, dass die Geschichte von Graffiti ja gerade zeigt, dass alles assimiliert werden kann: Das System assimiliert ja immer genau das, was nicht einverleibt werden will. „Wer sich entzieht, wird oft zum Star, so wie Banksy. Müssen wir eine Utopie des Entzugs heute nicht sogar aufgeben?“ Christoph Janke. Webmaster von Ueberdose.de, einer Berliner Graffiti-Website, skandiert im Gegenzug No-Sellout-Appelle: „Graffiti und auch Streetart haben sich in letzter Zeit für Geld so dermaßen flachgelegt, das geht gar nicht klar“ womit er vielen im Publikum aus der Seele spricht.
Während Stephane Bauer, Leiter vom Kunstraum Bethanien in Kreuzberg, gleich mit dem Totschlaghammer Adornos kommt oder vielleicht auch kommen muss – denn die Backjumps wurde stets über staatliche Förderung und zusätzliche Lifestyle-Sponsoren finanziert: „Ich habe keine Angst vor Sponsoren, wenn sie helfen, unsere Projekte zu realisieren, und sich zurückhalten. Denn es gibt kein richtiges Leben im Falschen – Adorno hat Recht damit, wir können uns dem nicht entziehen. Es geht hier eben auch um eine Verhandlung von Lebensraum“. Zugleich sieht Bauer einen Schutz in den Big Playern der Getränke-, Handy- oder Textilindustrie. Auch er spricht stellvertretend für viele. Man hat Angst vor Zuständen wie in Barcelona – wird Berlin die nächste graffitifreie Stadt? Immer öfter hört man: Jeder, der heute noch einen Job hat, muss dankbar sein. Sollte heute jeder Künstler, der mit seiner Kunst Geld verdient, nicht glücklich sein? Der Staat finanziert immer weniger Kulturförderung und sieht diese Aufgabe zunehmend bei der Wirtschaft, appelliert gar an ihre Mitverantwortung, die sie aber nur selten übernimmt ohne Forderungen zu stellen. Daher antwortet Cemnoz auf Janke: „Wenn du das Geld nicht nimmst, nimmt es ein anderer. Wenn du mit dem Geld was machen könntest, das unserer Sache zugute kommt, warum tust du es nicht? Die New Yorker Oldschool wollte nicht anonym bleiben, die wollten in die Kunstwelt, und das wollen wir auch.“
Wer wie Janke gegen Kooperationen mit der Werbewelt argumentiert gehört heute oft automatisch in die linke Schmuddelecke, ist ein Ewiggestriger. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Für genauso angestaubt hält man in der Werbebranche die Verfechter des klassischen und offensichtlichen Marketings. Beide Seiten müssen heute möglichst subtil agieren, wenn sie in keinen Fallstrick geraten wollen. Die großen nationalen Graffiti/Streetart-Ausstellungen der vergangenen paar Jahre haben aber genug offenbart, um die ewige Diskussion Straße versus Galerie oder Mainstream versus Untergrund im Bermudadreieck Werbung-Kunst-Sponsoring neu zu beleben. Endet diese Diskussion, dann wird Baudrillards Prophezeiung wahr, und Graffiti ist am Ende. Die Berliner Ausstellungen Backjumps Live Issue (Berlin 2003, 2005 & 2007), Outsides (\Wuppertal 2006) oder Planet Prozess (Berlin 2007) haben diverse Strategien in diesem Bermudadreieck ausprobiert.
„Wir befinden uns an einem Wendepunkt, weil Streetart – und das beinhaltet Für mich auch Graffiti – populär geworden ist. Aber die Leute können immer noch nicht richtig differenzieren was Guerilla-Marketing und was künsderischer Ausdruck aus Eigenantrieb ist, oder einfach: was gute oder schlechte Streetart ist. Es gibt Leute, die vom Trainwriting kommen, und welche, die von der Kunsthochschule kommen, beides kann gut sein, aber es ist nicht dasselbe“, so Lutz Henke, Kurator von Planet Prozess. Er und das Urban-Grassroots-Kollektiv haben 40 Künstler aus zwölf Nationen einen Sommer lang zusammengebracht. Wie war das möglich? „Hier hat niemand Geld verdient. Wir nicht und die Künstler auch nicht. Wir haben die unteren Beträge in der Fördermittelsparte bekommen, von der EU, vom Quartiersmanagement und von der Universität der Künste. Wir hatten ein minimales Sponsoring von Getränke- und Textilfirmen sowie Materialsponsoren.“ Es gab sehr viele Gespräche mit Firmen zwecks Sponsoring. aber man hat sich immer wieder dagegen entschieden, da die Eingriffe massiv gewesen wären. Bei der Endabrechnung wird man knapp im Minus landen. Es hat sich gelohnt – da ist man sich einig -. aber noch einmal kann man es nicht so machen, zu extrem war die Selbstausbeutung.
Trotzdem will Lutz in Zukunft ganz vom Sponsoring weg: „Förderungen lassen zwar viel Freiheit, sind aber viel zu viel Arbeit: Du musst die Strukturen und Leute kennen, dich in die Antragsprosa
und Verfahren einarbeiten und die Abrechnungen hinbekommen. Wenn sich über Verkäufe alles finanzieren würde, wäre das optimal.“
Nur gab es bei Planet Prozess kaum Objekte, die man hätte verkaufen können, man schaffte stattdessen Bezugspunkte, die die Eigeninitiative des Betrachters fordern: „Die meisten Projekte waren viel subtiler, als man es gewohnt ist, und dadurch war es auch nicht so verwertbar für den aktuellen Hype. Viele Besucher haben erst nach der zweiten Vernissage/Bergfest verstanden, worum es eigentlich geht.“ Denn die Ausstellung fand hauptsächlich draußen, in der Stadt selbst sratt, im Innenraum wurde vorbereitet, dokumentiert, kommuniziert, gefeiert – der Senatsreservenspeicher und seine 1200 Quadratmeter waren ihr Stützpunkt.
Lutz findet, dass die Künstler überhaupt davon weg sollten, sich über Lifestyle-Firmen zu finanzieren: „Denn da musst du immer machen, was die Firma und der Markt wollen. Man macht einfach nicht mehr das, was man selber will, und das auch noch für wenig Geld.“ Lutz betont, dass Urban-Grassroots nichts mit „diesem Graswurzelhippieding“ zu tun habe, aber ihr Projekt beweist das Gegenteil. Eine Haltung, die der Berliner Writer-Szene seit langem anhaftet, es hatte den Anschein, als hätten gerade sie Baudrillard verinnerlicht. Ein weiterer Höhepunkt in dieser Tradition war die City of Names im Rahmen der Backjumps Live Issue #2 (siehe BACKSPIN#7I). Mittlerweile ist jede Firma, die irgendwie mit „urban“ wirbt, in Berlin, und viele Writer sind bereits in die Lifestyle-Mühle geraten, auch sie müssen von irgendwas leben. Das wissen auch die Firmen.
So entstand die Ausstellung „Outsides“ sogar auf Initiative einer Getränkefirma. Denn es gab in Berlin schon immer verschiedenste Guerilla-Aktionen der Writer-Szene im öffentlichen Raum, wo man sich einfach in einer Invasion den Raum nahm und in großen Gruppen ausstellte. Das inspirierte den Getränkehersteller dazu, das Ganze auf ein „Next Level“ zu pushen. Größer, dreister, krasser, besser – und zwar diesmal in einer anderen Stadt. Thomas Wiczak ist die eine Hälfte der Kuration von „Outsides“ gewesen: „Mir war nicht so richtig klar, wofür ich mich entschieden hatte. Ich bin da mit viel Idealismus reingegangen, und das Projekt hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich wirklich bewusst positioniert habe. Ich hatte vorher bei vielen Aktionen mitgewirkt, wo viele Leute zusammengekommen sind, und ,Outsides‘ war eine Weiterführung, auf einer anderen Ebene und mit anderen Mitteln.“
Thomas glaubte, man könne den Unterstützer und Initiator mit gemeinsamer Kraft in den Hintergrund drängen, im Nachhinein findet er das selbst etwas naiv. „Die ganze Präsenz des Getränkeherstellers hat in Berlin in unserer Szene ja auch schon Geschichte, und es hätte nie so weit kommen können, wenn wir es nicht auch zugelassen hätten.“ Dieses Unternehmen isr dafür bekannt, ein angenehmes und soziales Ambiente für seine Künstler zu kreieren. So residierten die 22 nationalen und internationalen Künstler in einer außergewöhnlichen Villa in Wuppertal, um die eigentliche Ausstellung im Außenraum in Workshops vorzubereiten. Auch intellektuelle Koryphäen gehörten zum Team. So auch Wirtschaftswissenschaftler Prof. Franz Liebl, der sich auf strategisches Marketing spezialisiert hat: „,Outsides‘ sprengt jede Marketing-Kategorie, denn es repräsentiert weder die typischen Marketing-Strategien noch Guerilla-Kampagnen oder Event-Marketing.“ Deshalb kann man „Outsides“ wohl am treffendsten als Greyzone-Marketing beschreiben. Man erhofft sich eine steigende Identifikation mit der Marke bei den Konsumenten. Laut Liebl sollte gerade Nonkonformismus das zentrale Mantra im Wertesystem der Firma verkörpern. Was „Outsides“ und ihre Teilnehmer nicht perfekter repräsentieren könnten, denn Genehmigungen oder Absprachen mit Wuppertal waren selbstverständlich nicht Teil des Projekts.
„Eine Handvoll Firmen ist ja schon seit jahren in dieser Szene umtriebig. In der Geschichte dieser Verbindung ist es ein weiterer Clou, es fragt sich nur, für wen. Es gab auch jede Menge Absagen, weil viele dann doch wegen der Firma Gänsehaut bekommen haben, obwohl sie die Aktion an sich super fanden“. so Wiczak. Gerade das Kontliktpotential, die Reibungsfläche von Outsides war für ihn interessant. Die Teilnehmer von Outsides haben dabei alle Geld verdient, vielleicht zu viel, denn die Projekte waren größtenteils nicht mehr dem Graffiti- oder Streetart-Bereich zuzuordnen, sondern eher ambitionierte Kunstprojekte. Denn das Geld war da, und man konnte sich einfach mal anders ausprobieren. „Was äußerlich passierte. ist trotzdem eher uninteressant, viel spannender ist das, was es in den jeweiligen Kreisen ausgelöst hat“, findet Wiczak. „Wie werten die Künstler das aus? Oder die Firma?“ Das Projekt begann 2005, die Vernissage war im August 2006, und Thomas Wiczaks persönliche Auswertung führte dazu, dass er im Novemher 2006 aus dem Projekt ausgestiegen ist: „Ich habe ordentlich mit mir gehadert. Obwohl es spät passiert ist, war es mit wichtig, dieses Beziehungsgefüge von Writing und Getränkehersteller wieder zu trennen.“
Wiczak ist nicht alleine mit seinem Standpunkt, wenn er meint, es gäbe bisher keine geglückten Präsentations-Versuche von Streetart oder Writing im Innenraum: „Eine Ausstellung kann nur gut sein, wenn sie illegal wäre. Aber wer unterstützt solche Gesetzesüberschreitungen? Vielleicht sollte es einfach gar keine Ausstellungsversuche in einem solchen Ausmaß mehr geben. Vielleicht ist das eine Sackgasse?!“
Graffiti ist keine Kunst. Graffiti liegt außerhalb einer Kunst-Definition, das fand auch Baudrillard. Trotzdem sollte es vom Kunstmarkt anerkannt werden. Lutz Henke meint, es hat seine Existenzberechtigung in dieser Welt: „Writing hat ein Recht darauf, als wichtiges kulturelles Gut wahrgenommen zu werden, ohne deshalb Kunst sein zu müssen, daher unser Untertitel: Zwischen Raum und Kunst“. Die Backjump-Ausstellungen 2003 und 2005 waren beeindruckende Versuche in dieser Richtung, aber sie haben gleichzeitig dazu beigetragen, dass die figurativen Streetart-Werke von Swoon oder Banksy inzwischen für 100 000 Euro und mehr verkauft werden, was auch Probleme erzeugt: Diese Künstler können oft gar nicht mehr auf der Straße ausstellen, selbst wenn sie es noch wollen. Ihre Bilder haben keine Chance mehr, dort zu bleiben. Sie werden von den Wänden gekratzt oder aus der Wand gemeiselt, was ihre Verwertbarkeit noch unterstreicht. Deshalb war der „Banksy-Faktor“ auch zurecht bei der Baudrillard-Diskussion ein zentrales Thema. So fragt Bauer: „Warum machen wir eigentlich noch Backjumps, wenn doch der Herausgeber der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘ und die Deutsche Bank, die ja Bilder von Banksy gekauft haben, schon zu uns gehören?“ Der FAZ-Herausgeber sammelt eben selber Kunst, und die Deutsche Bank hat Anteile an der FAZ. Diese Bezüge verraten uns aber nicht, ob sie Kunst als gute Geschäftsmänner oder aus Überzeugung sammeln. Ist ein solcher Kauf als Künstlerstipendium gemeint oder als schlaue Investition?
Kann es heute noch Zeichen geben, die nicht verwertbar sind? Deutlich wird bei diesem Rückblick, dass, wenn man heute über den Aufstand der Zeichen redet, ihn niemand lieber machen würde als diese Lifestyle-Firmen. Das findet auch Knut Ebeling: „Diese Unternehmen würden ihn liebend gerne als ganze Kampagne kaufen. Denn niemand ist heute interessierter an der symbolischen Ebene als solche Leute.“