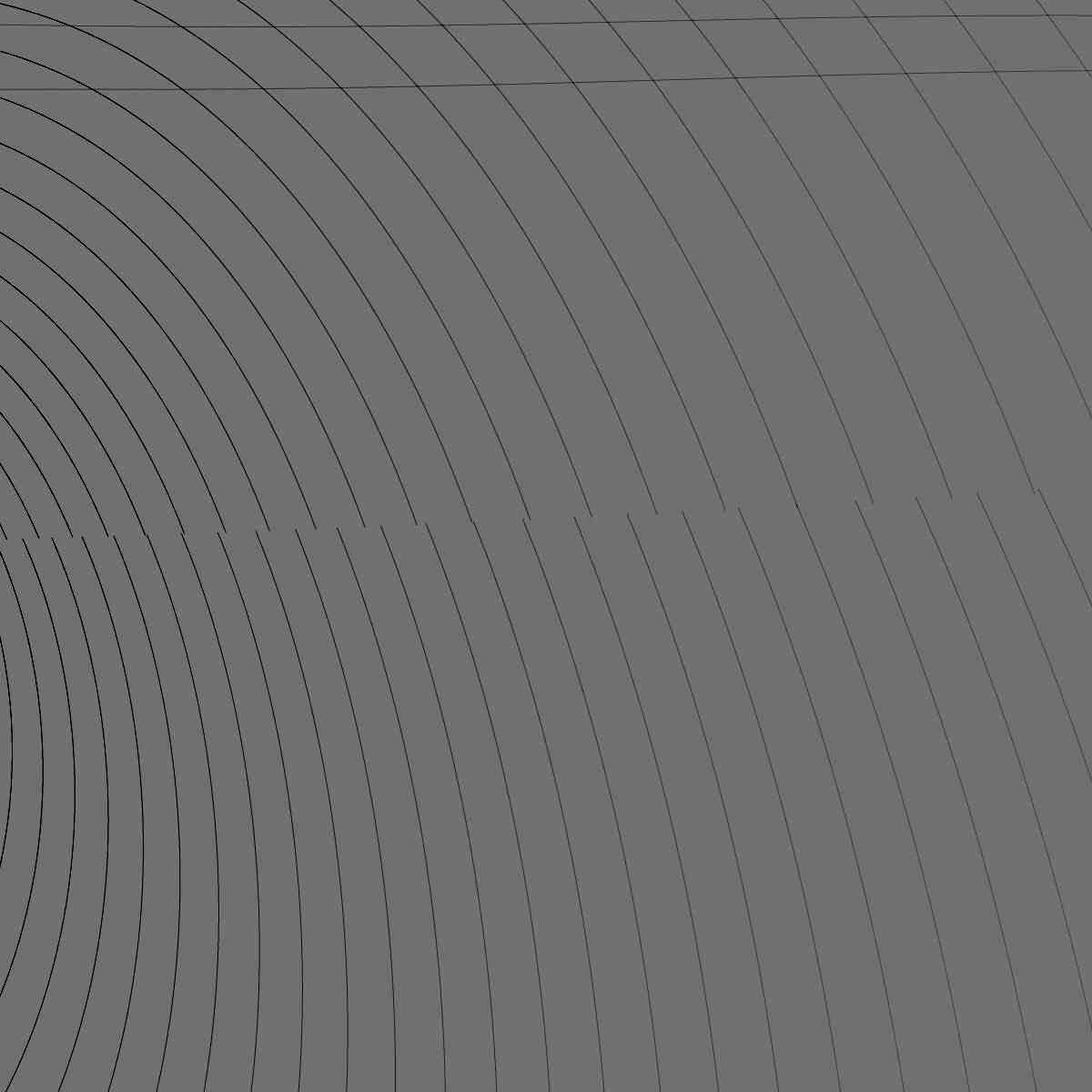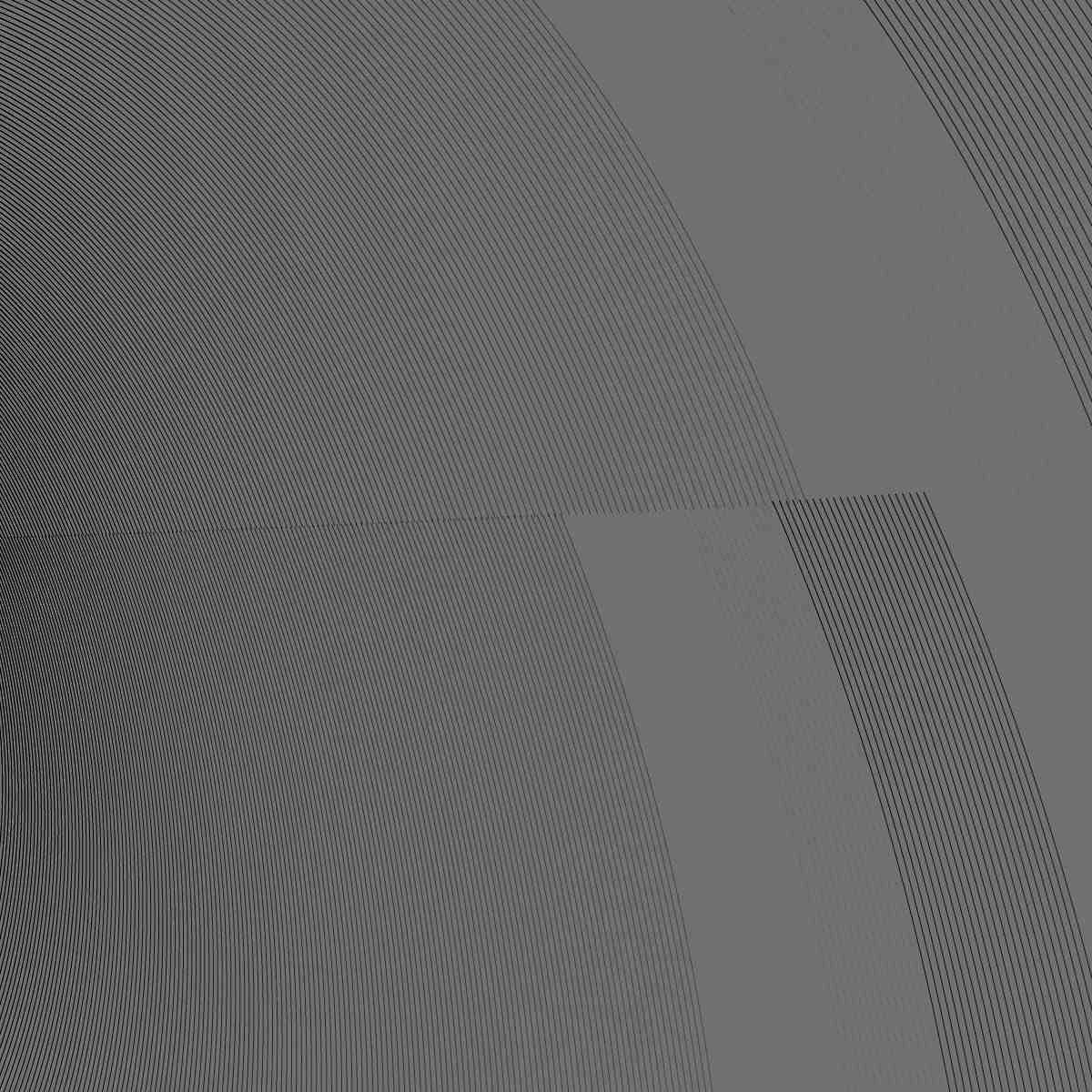Text Bianca Ludewig
M.I.A. a.k.a. Maya Arulpragasam ist schön und fotogen, ihre Biografie interessant. Und ihre Musik ist aufregend anders. In DJ-Sets von Grime bis Reggaeton trieb sie die Menschenmengen über Dancefloors. Zunächst in England und später in ganz Europa. All das machte sie schnell zum „Everybody’s Darling“ in Medien und Musikindustrie. Und zwar in einem rasant schnellen Tempo. So schnell, dass man ihr die Daumen drücken möchte. Dafür, dass diese Dynamik nicht unkontrollierbar wird und in einem Crash endet. Dieses Jahr ist M.I.A. für verschiedene Awards nominiert.

„Statt mich nachts hinter einem Baum zu verstecken, um ein Stencil zu sprühen, wollte ich durch Musik direkt sagen können, was in mir vorgeht.“
Ihr Name M.I.A. – „Missing in Acton“, einem Stadtteil von London, in dem M.I.A. gewohnt hat – entstand als Titel zu ihrer ersten Ausstellung. Das Ganze ist auch eine Art Metapher auf ihre persönliche Geschichte. Sie ist in England geboren, aber schnell ging es wieder nach Sri Lanka, dann nach Indien und vice versa. Mit elf ging es schließlich zurück nach England. Seit weniger als drei Jahren macht M.I.A. überhaupt erst Musik. Vorher hat sie hauptsächlich Kunst gemacht: Filme, Fotos, Bilder. Denn Malen funktionierte für die Tochter eines Widerstandskämpfers immer und
überall gut: „Wir wechselten oft unseren Aufenthaltsort, aber egal in welchem Haus wir endeten, ich zeichnete. Das war in all der Unsicherheit etwas Beständiges und Mögliches“, erzählt MIA. So dachte auch jeder, dies sei eben ihr Talent. Und ihre fehlende Berührungsangst mit der elitären Seite von Kunst half ihr auch dabei: …Ich war einfach dumm und naiv. Wenn ich ein Gebäude sah, das schön war, ging ich rein. So fand ich heraus, dass viele dieser geleckten Orte, wo Menschen herumstehen und Champagner trinken, Galerien sind und dass es hier Kunst gibt.“
Inzwischen ist dank der Kunst die Erinnerung an Bürgerkrieg, Flüchtlingsheime und ärmliche Verhältnisse verblasst. Ihr Kompensationstrip durch Sneakers und Klamotten scheint auch überwunden. Sie macht jetzt selber Ausstellungen. Bei ihrer Ausstellungspremiere 2001 wurde alles gekauft, hauptsächlich von Schauspieler Jude Law. Mit dem Geld bezahlte M.I.A. nicht ihre Schulden, sondern die Reise in ein angemessenes Ambiente zum Nachdenken über ihre Zukunft: die Karibik. Dort erfasste sie das Dancehall-Fieber: „Es gab immer und überall Musik. Ich ging jede Nacht tanzen und fühlte mich durch die Musik geborgen. Es hat mich gepackt und seither nicht mehr losgelassen.“
Bei ihrer Musik wendet M.I.A. Cut-up und andere Techniken an, die sie zuvor in ihrer visuellen Kunst einsetzte. Dadurch entsteht ein wahrhaft rough & rawes Abbild von der Musik, die wir als Weltmusik, Dancehall, Garage, Hip-Hop, Punk oder Crime kennen. Für ihren Sound gibt es noch keinen Namen: „Meine Mutter, meine Freunde, jeder fragte: ‚Was ist das?“ Aber ich wusste es selbst nicht. Jemand sagte mir dann, dass, sobald meine Single rauskommt, durch die Medien ein Name dafür gefunden wird. Jetzt sind es zwei Jahre, und niemand hat es bisher adäquat benannt.“
lm Zusammenhang mit M.I.A. wird oft der tamilische Tiger erwähnt – der auch in ihrer Kunst auftaucht -, und obwohl sie viel leiser und schüchterner rüberkommt, als man sie sich vorstellt, hat sie tatsächlich manchmal etwas von einem Tiger. Denn bei manchen Fragen kommt, wie die Kralle aus einer weichen Tigertatze, überraschend eine Art Antwort-Attacke. Die hat denn etwas Rohes und Unerwartetes, das aber besonders auf Nachfrage schnell wieder verebbt. Dennoch: Ich will den Tiger kitzeln! Mehr davon! Ich frage sie, wo eigentlich der Hip-Hop in ihrem Sound ist, von dem alle Journalisten und Promotypen immer reden? „Er ist irgendwo da drinnen“, sagt M.I.A., Hip-Hop war ja nur die erste Musik, die ich entdeckte, als ich nach England kam. Und Rap beeinflusst meine Musik auch immer noch, denn lyrisch will ich genau das Gegenteil von dem, was Rapper tun.“ Ja, da war er wieder, der Tiger! Sie lächelt dabei. Den Tiger hat sie wohl von ihrem Vater. Der neigt, so sagt sie, zur politischen Obsession, während ihre Mutter zu religiösem Fanatismus tendiert: „Meine Mutter findet, wer die Welt verändern will, der sollte mit den Leuten in seiner unmittelbaren Umgebung beginnen. Sie geht fünfmal die Woche in die Kirche und hat etwas von einer Heiligen. Unser Haus war immer leer, weil sie alles verschenkt hat. Meinen Vater hat die Familie nicht interessiert, sondern die Welt. Er wollte vom Großen ins Kleine.“ M.I.A. findet, dass beide Ansätze so nicht funktionieren und dass sie von beiden Elternteilen etwas mitgenommen hat, aus dem sie eine neue. verträglichere Mischung kreiert.
Diese oft unvereinbaren Gegensätze, die ihr Leben bestimmten, spiegeln sich sowohl in ihrer Musik als auch in ihrer Kunst wider. Wo Gegensätze und Grenzen sich auflösen, fühlt sie sich wohl. Daher auch ihre Begeisterung für Graffiti oder Urban-Art: „Streetart ist Community-Art. Volkskunst hatte aber immer dieses Stigma, langweilig und unwichtig zu sein. Streetart und Graffiti
haben das umgedreht und die Leute, die Kids in der Nachbarschaft damit infiziert, selbst Kunst zu machen. Das ist faszinierend, denn ich finde, Kunst muss zurück zu den Menschen kommen, sonst ist sie sinnlos.“
Besonders England braucht diesen Aktionismus, findet M.I.A. – denn die Inselmentalität macht verkopft und apathisch. So weit weg vom Aktivismus der sechziger und siebziger Jahre in Russland, der damaligen Sowjetunion, von dem ihr Vater immer schwärmte. „An der Kunstschule haben wir gelernt, mit möglichst vielen Worten nichts zu sagen, deshalb bin ich nach der Schule total in diesem Streetart-Aktivismus aufgegangen, etwas in mir ist da aufgewacht“, erzählt M.I.A. Auch der Tod eines Cousins bei einem Selbstmordattentat hat mit zu dieser Veränderung beigetragen. Vom oberflächlichen Studentenmädchen zur Frau mit Anliegen – und zur Wandlung von M.I.A., zur Musikerin: „In der Kunst war ich immer zu verbal – meine Persönlichkeit überschattete meine Kunst. Deshalb hab ich am Ende nachgegeben und gedacht: ‚Scheiß drauf, ich sag’s ihnen einfach.‘ Statt mich nachts hinter einem Baum zu verstecken, um ein Stencil zu sprühen, wollte ich durch Musik direkt sagen können, was in mir vorgeht.
Und das macht sie jetzt. Auf eine sehr roughe, energetische und dabei erfolgreiche Art und Weise. Durch Peaches inspiriert und angeleitet, bastelte sie zunächst Beats mit der 505 – so entstand auch das Grundgerüst zu ihrem ersten Demo mit sechs Tracks. Auf Dauer waren M.I.A. aber die Sounds der 505 zu limitiert, und ihr fehlte dabei der fette Bass und analoger Input. So holte sie sich Hilfe. Mit der ungehemmten Begeisterung für eine neue Leidenschaft fragte sie anfänglich jeden Produzenten, der ihren Weg kreuzte und Lust hatte, abzugehen. Diese verschiedenen Einflüsse machten sich dann auf dem Album auch – aber nicht nur – positiv bemerkbar. Für ihr Album „Arular“ produzierten Switch, Richard X, Ross Orten (Fat Truckers), Steve Mackey (Pulp) und Diplo (Big Dada/Ninja Tunes).
Nachdem M.I.A. Musik von Diplo gehört hatte, wollte sie ihn für sich gewinnen. Als sie ihn bei einem seiner DJ-Gigs in London suchte und er „Galang“ spielte, als sie reinkam, war das für sie ein Omen: „Obwohl er sehr jung ist und aus den Staaten kommt, hat er einen ähnlichen Background und eine ähnliche Philosophie wie ich. Und er macht genau das als DJ, was ich als Musikerin mache: Techniken, die man beim Filmemachen benutzt, auch auf Musik anzuwenden. Das haben die meisten Produzenten nicht verstanden. Diplo hat selbst Filme gemacht, er verstand sofort, was ich wollte.“ Leider ist Diplo sehr beschäftigt – ständig ist er in Brasilien, den USA, Japan oder sonst wo und hat einen eigenen Willen, was die Koordination für gemeinsame Live-Performances erschwert. M.I.A. scheint Diplo sehr zu mögen, aber gleichzeitig will sie einen DJ ganz für sich alleine, weshalb nun DJ Contra ihr DJ für Live-AuFtritte ist.
Sicher ist: Bei so einem speziellen Patchwork-Vocalstyle wird auch ein besonderer D] gebraucht. Ihr Stil ist auf ihre innere Sri-Lanka-Jukebox zurückzuführen: „Mein Gesang ähnelt alter Volksmusik aus Sri Lanka. Da gab es diese Gruppen von Geschichtenerzählern, die von Dorf zu Dorf zogen und begleitet von einem alten Volksinstrument ihre Geschichten erzählten. Um das Interesse der Leute aufrecht zu erhalten, machten sie dabei diese ganzen verrückten Geräusche: religiöses Murmeln zusammen mit schrillen Sounds und diesem rohen, harten Erzählstil. Das habe ich im Kopf, wenn ich singe.“
Als wir auf UK-Hip-Hop zu sprechen kommen, zeigt sie ein letztes Mal den Tiger inside: Nachdem sie zunächst gelangweilt erwidert, es gäbe keine Rapper mit Charisma in England – und, klar, Roots Manuva sei ein ganz passabler Musiker -, wird M.I.A. plötzlich ernst. Sie sei sauer auf die englische Hip-Hop-Community. Wegen Roots Manuva. Denn der hat in ihren Augen nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. „Er ist einer der Besten, die wir haben, denn er ist nicht nur gut, sondern hat auch was zu sagen. Er sollte eine wichtige Inspirationsquelle für die Kids sein.“
Vielleicht denkt sie das, weil Roots Manuva nicht so ein Frauenbild hat wie viele andere Rapper. Jay-Z musste jedenfalls erst mal Fünf Absagen von M.I.A. einstecken, bevor sie bei Def Jam vorbeikam. Denn der Titten-und-Ärsche-Missbrauch an Frauen spricht sie nicht gerade an. Weshalb eine Zusammenarbeit mit Def Jam zwar nicht wahrscheinlich, aber kategorisch nicht ausgeschlossen ist. Doch auch aus Soundperspektive ist so eine Kollabo schwer vorstellbar. Aber wenn man bei M.I.A. mit einem rechnen muss, dann mit Überraschungen – und die kommen dann mit mindestens 200 Kilometer pro Stunde! Deshalb: Holla for some speed limits – and more M.I.A.!