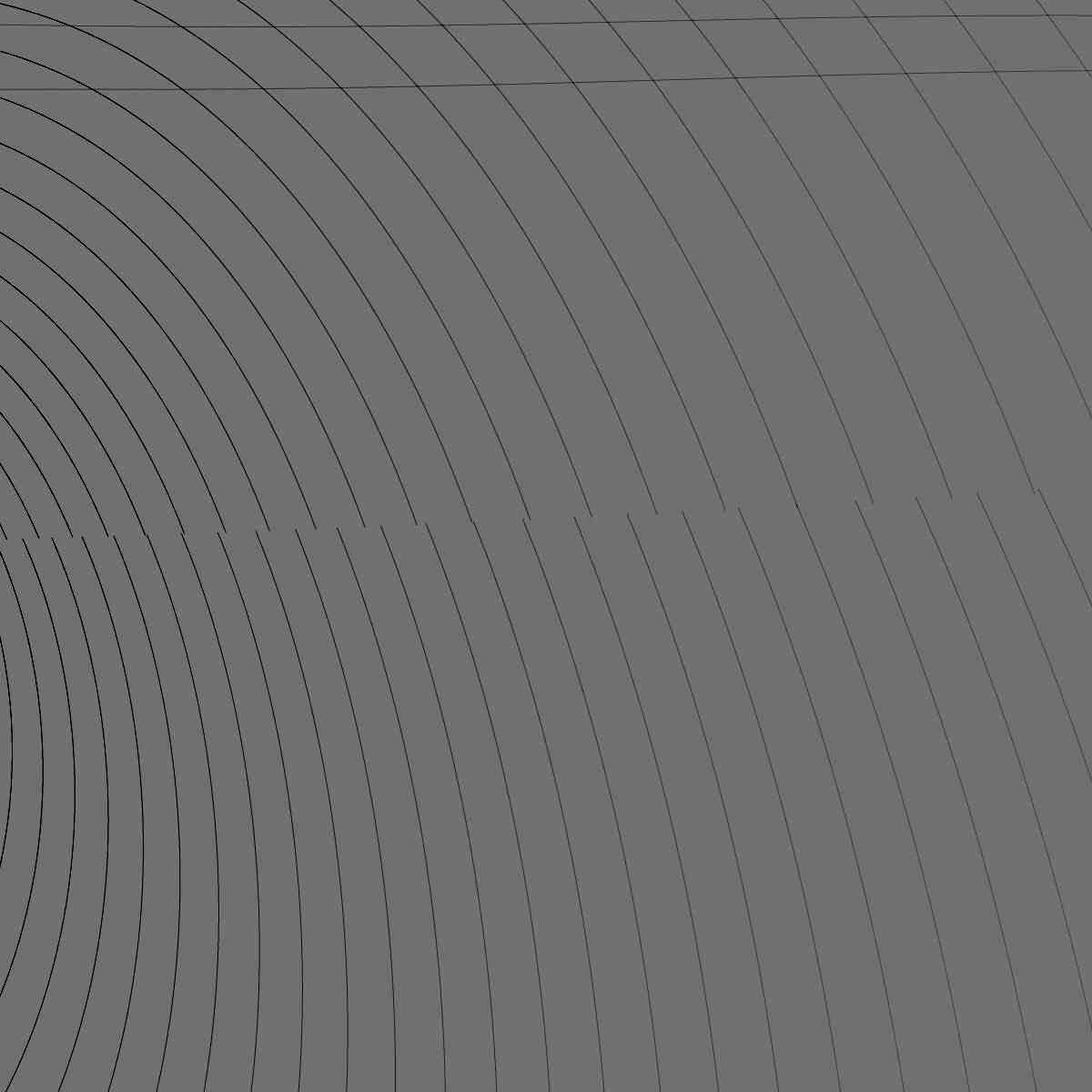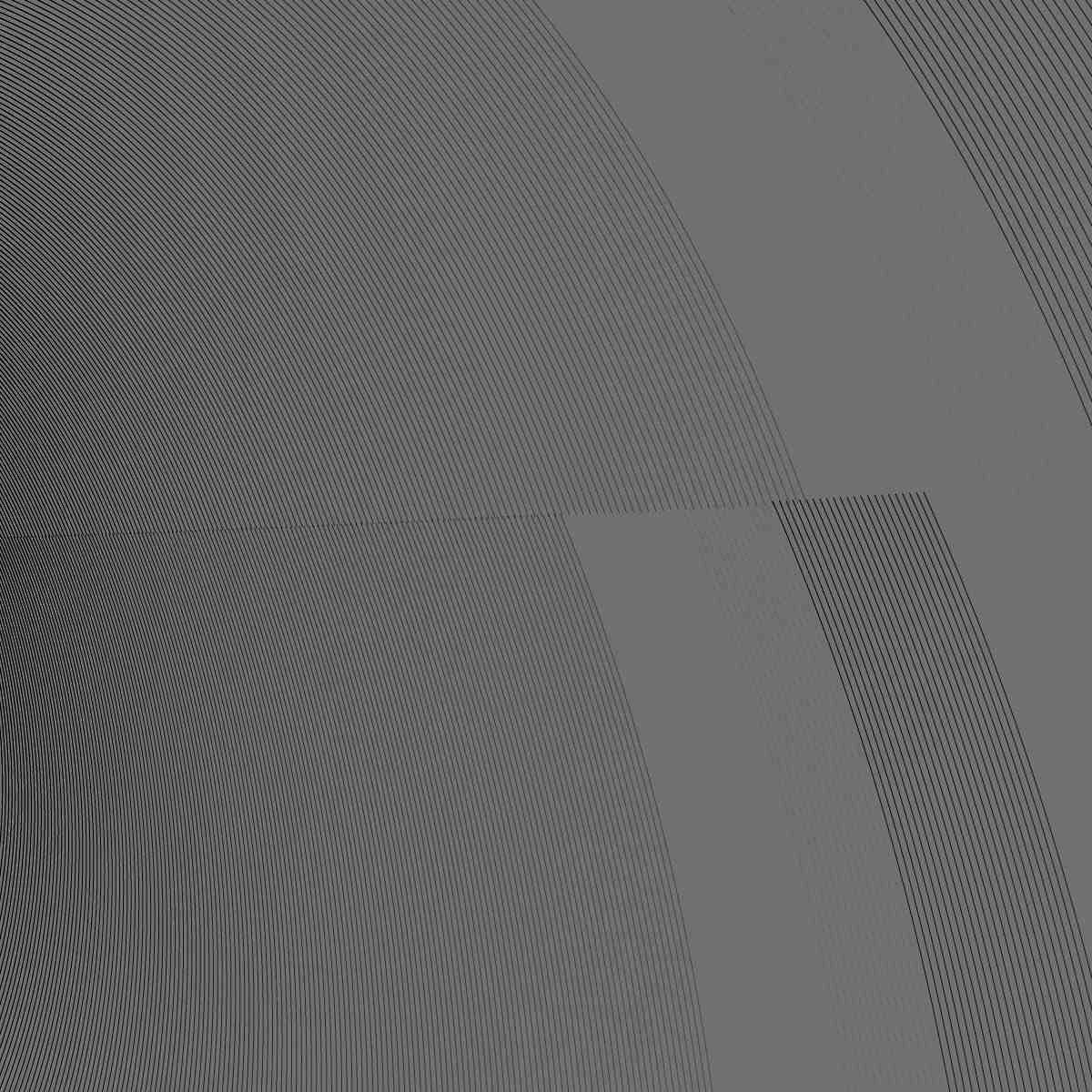Institutskolloquium 18.05.2017, Universität Wien
Da diese Sitzung als Werkstattgespräch angekündigt wurde, habe ich dies als Möglichkeit zu einer freieren Gestaltung gesehen. Daher habe ich Georg Wolfmayr gebeten mich zu interviewen, da er auch in gewisser Weise Teil des Feldes ist, weil er sich für diese Art von Musik interessiert und auch solche Festivals besucht. Ich freue mich, dass er sich dazu motivieren ließ!
Als Einstieg möchte ich einen Ausschnitt aus einem Film zeigen, der von dem Festivalnetzwerk ECAS – European Cities of Advanced Sound in Auftrag gegeben wurde, welches auch Teil meiner Forschung ist. ECAS umfasst 20 Festivals und war auch ein EU Projekt von 2010-2015 an dem 9 Festivals teilnahmen und im Rahmen der Dokumentation des EU Projekts ist dieser Film entstanden. Der Film wurde von den meisten Beteiligten nicht für besonders gelungen oder aussagekräftig befunden, trotzdem war es ein Versuch, ein Test, dieses doch eher abstrakte Feld darzustellen. Wir sehen das Intro und im Anschluss den Teil über das CTM Festival in Berlin, welches ich am längsten beforscht habe.
Georg Wolfmayr: Was ist dein Forschungsinteresse? Was ist der Gegenstand deiner Forschung? Was sind transmediale Festivals? Was ist der Unterschied zu gewöhnlichen Musikfestivals?
Bianca Ludewig: Mein Forschungsinteresse waren Avantgarde Festivals der elektronischen Musik, denn in Berlin hat man immer wieder Plakate für das CTM Festival oder transmediale gesehen, die ich aber nicht verstanden habe, die ebenso abstrakt waren wie die Festivals selber. Auch auf ersten zögerlichen Besuchen hat sich mir nicht erschlossen, was hier genau abläuft, daher wollte ich das herausfinden. Auch ist mir dann aufgefallen, dass es allerorts solche Festivals gibt, aber keine Forschung dazu. Offensichtlich war, dass es eine Schnittstelle zur Club Kultur gab, zu der ich ein gespaltenes Verhältnis habe, denn ich mag die Musik und habe diese auch über Jahre, wenn auch am Rande verfolgt, aber ich mochte die Events nie besonders gerne. Auch schienen Festivals im Zuge von Eventisierung und Festivalisierung der Städte ein relevantes Thema, was unter diesen Vorzeichen auch noch nicht genügend erforscht war.
Was sind also transmediale Festivals? Dieser Begriff ist erst einmal ein Arbeitsbegriff und kommt aus meinem Feld, er steht eigentlich für das Erkunden neuer Darstellungs- und Präsentationsformen und zielt letztendlich auf Inter- oder Transdisziplinarität ab. Begriffe die bei diesen Festivals hoch im Kurs stehen. Auch, weil es auf den Computer verweist, auf Labtop Producing, Soundart, Medien- oder Netzkunst verweist, denn Digitalisierung ist für die meisten dieser Festivals ein wichtiger Motor gewesen, sie sind im Zuge dieses Prozesses entstanden und groß geworden. Für diese Präsentation habe ich mich bewusst gegen den Begriff der Transmedialität entscheiden und Avantgardefestivals benutzt, weil dies ebenfalls ein Begriff ist, der diese Festivals fasst. Nur, dass es eben Avantgarde Festivals der Jetztzeit sind und diese sind stark mit den technologischen Neuerungen und Veränderungen verbunden. Auch der Begriff der Avantgarde-Festivals ist eben nicht ganz ausreichend, denn es gibt auch Avantgarde Festivals, die keine transmedialen Festivals sind und nicht in mein Forschungsfeld fallen. Avantgarde Festival ist aber verständlicher als transmediales Festival denke ich, auch weil der Begriff der Avantgarde bekannter ist. New Music Underground Festivals wäre ein weiterer möglicher Begriff, der aber auch nur einen Teilbereich umschreibt und sehr vage ist.
Der Unterschied zu anderen Musikfestivals ist – sehr knapp formuliert – dass die Festivals meist in Großstädten stattfinden und die städtische Infrastruktur der vorhandenen Kulturräume nutzen: Clubs, Theater, Kunsträume – und sie haben eine starke Überlappung zur Kunstwelt. Sowohl personell von den involvierten Akteur*innen und Szenen, als auch von den Darstellungsformen wie der Präsentation von Ausstellungen und Installationen oder sogenannter Kunstmusik. Die Kurator*innen kommen nicht selten aus diesem Bereich bzw. haben eine künstlerische Ausbildung, welche sich auf die Kuration auswirkt, die den Geboten der Kunst folgt, nicht denen des Musikmarkts.
GW: In welchem Zeitraum und auf welchen Festivals hast du geforscht? In welcher Phase befindest du dich?
BL: Ich habe von 2013-2017 geforscht, dieses Jahr möchte ich die Datenerhebung endgültig abschließen. Ich habe vor allem Festivals in Österreich und Deutschland beforscht, einfach weil es auch eine finanzielle Frage ist – Festivals sind teuer: Festivalpass, Fahrtkosten, Übernachtung, Getränke & Essen – da kommt einiges zusammen. Sehr genau habe ich mir das CTM Festival in Berlin in den letzten 5 Jahren angeschaut, vier Jahre war ich beim Heart of Noise Festival in Innsbruck oderund ebenso oft beim Elevate Festival in Graz. Dann gibt es einige Festivals, wo ich nur einmal oder zweimal dabei war, dort habe ich dann gearbeitet – als Volunteer, Guide oder Journalistin, so beispielsweise so bei der Ars Electronica in Linz, beim Atonal Festival Berlin, donaufestival Krems oder beim Rokolectiv Festival in Bukarest. Oder auch beim ECAS Abschluss Festival in Dresden, das nur einmalig stattfand.
Dann gibt es noch weitere Festivals, die ich auch im weitesten Sinne zu meinem Forschungsfeld zähle, wo ich aber nur teilgenommen habe – Unsafe and Sounds in Wien, oder Märzmusik, Mira Festival und Heroines of Sound in Berlin.
Ich befinde mich nun schon länger in der Abschlussphase meiner Datenerhebung und Auswertung, es kommen mir immer wieder neue Festivals bzw. Entwicklungen in die Quere. Aber ich denke das Material ist nun gesättigt und es muss jetzt vor allem aufgeschrieben werden.
GW: Welche AkteurInnen sind für deine Forschung relevant? VeranstalterInnen, KünstlerInnen, BesucherInnen? Wie bekommst du diese unterschiedlichen Ebenen zusammen? Inwiefern gibt es eine inhaltliche Klammer?
BL: Alle diese Gruppen sind für meine Forschung relevant. Und zwar vor allem in der Form als dass viele all dies zugleich sind. Zu nennen wären auch noch die Journalist*innen, Promoter, Booker*innen, Festivalmacher*innen – diese werden häufig Akkreditierte Fachbesucher*innen genannt und beim CTM Festival waren das 1000 Personen in 2015. Erst einmal wäre ja zu Fragen wer alles zum Feld gehört? Und da man nicht alle befragen oder teilnehmend beobachten kann, muss man sich für eine Auswahl entscheiden. Ich habe mich für allem für jene interessiert, die ich Aktivist*innen nenne, weil sie wie auch immer zu der Kultur beitragen und Teil des größeren Netzwerks sind. Und zu den Veranstaltern gehören ja nicht nur die Kurator*innen, sondern das ganze organisatorische Team. Dies ist meist aus einigen Professionals jenseits der Szene sowie aus ehemaligen Aktivist*innen und Festivalbesucher*innen zusammengesetzt. Letztere haben quasi nur die Seite gewechselt – aus einem Bedürfnis stärker involviert zu sein. Mich haben vor allem auch die Praktikannt*innen und Volunteers interessiert; und bei dieser Gruppe ist es so, dass viele langjährige Festivalbesucher*innen sind, die selber auch schon veranstaltet haben, über Musik schreiben, akademisch zu Musik oder Medien forschen und selber Musik machen oder DJs sind.
Dies gilt eben auch für viele Besucher*innen und oft sind die eingeladenen Musiker*innen selber auch Veranstalter*innen, Booker*innen oder Labelbetreiber*innen, weil sie sich so ein Netzwerk aufbauen, welches gerade heute und vor allem bei so einer Spartenmusik sehr wichtig ist. Jedoch habe ich Künstler*innen nicht primär im Fokus gehabt, sondern diese vor allem für journalistische Zwecke interviewt, das heißt wir haben vor allem über ihre Musik gesprochen. Aber wiegesagt viele, die auch für die Festivals arbeiten sind eben auch Musiker*innen. Wichtig war mir, nicht nur die Besucher*innen in den Blick zu nehmen, denn das ist der klassische Fokus in der Festivalforschung und auch in der Europäischen Ethnologie und da wollte ich ein weiteres Blickfeld aufmachen. Am liebsten würde ich die ganze Struktur, die notwendig ist um ein solches Festival größeren Ausmaßes zu organisieren, ethnografisch beforschen, von den Kooperationspartnern, Sponsoren und Förderinstitutionen bis zum Künstlermanagement und den Techniker*innen, dies ist im Rahmen einer Doktorarbeit leider nicht möglich, zumal nicht ethnografisch da jedes Subfeld Gatekeeper hat und der Zugang, die Spezialisierung, erst hergestellt werden muss.
Die inhaltliche Klammer bin ich als Forscherin und das, was das Feld an Anschlussstellen vorgibt bzw. zurückgibt. Aber auch das, was vorgegeben ist, wie der Raum, also die Stadt und der Inhalt, die Musik bildet eine Klammer.
GW: Welche Rolle spielen Stadt und Land bei den Festivals? Sind die Festivals ein „urbanes“ Phänomen? Wie unterscheidet sich dann Donaufestival (Krems) und CTM (Berlin)?
BL: Ländliche Regionen spielen keine große Rolle bei meiner Studie, da ich diese Art von Festivals explizit im urbanen Kontext verorte. Es gibt auch Festivals, die in Kleinstädten stattfinden, wie Krems, jedoch hängt dies vor allem mit lokalen Förderstrukturen zusammen. Die Festivalmacher*innen bzw. Kurator*innen leben dann auch in der nächstgelegenen Großstadt und auch das Publikum, das erreicht werden soll, kommt aus der nächstgelegenen Großstadt, im Falle von Krems eben aus Wien. Die Infrastruktur der Veranstaltungsorte, die angeboten wird ist auch eine urbane – Galerien, Kunsthäuser, Kirchen, Theater, Konzertsäle – ähnlich dem Vorbild der Festivals in den Großstädten. Die Wurzeln dieser Festivals sind sowohl in der urbanen Club Kultur, der Digitalisierung, als auch in den Kunstschauen zu finden. Während ein Festival wie CTM auch auf ein internationales Publikum abzielt, (2015 waren es 50% internationale Besucher, 10% national und 40% regional), ist das donaufestival eher auf ein Publikum aus Österreich ausgerichtet, vor allem aus Wien. Inhaltlich unterscheiden sich die Festivals auch – während sie sich in der präsentierten Musik gleichen. Aber das donaufestival hat einen zweiten Schwerpunkt auf Performance und CTM hat ihn auf Medienkunst/ Soundart. In den letzten Jahren gab es immer eine Ausstellung sowie ein paar Installationen an anderen Orten (leider oft bei zusätzlichem Eintritt für Letzteres). Interessanterweise nennt CTM unter ihren wichtigsten internationalen Partnern neben dem Mutek Festival Montreal auch den ORF und das donaufestival. So werden von den Festivalbesucher*innen immer wieder die gleichen Festivals genannt auf die sie fahren oder fahren möchten. Bei den Österreichern ist das Donaufestival immer mit dabei, Deutsche fahren eher zu CTM oder Atonal, weil es näher und günstiger ist. Aus beiden Ländern fährt man gerne auf das Unsound Festival in Krakau.
GW: Du sprichst in deiner Forschung von Szenen: Was zeichnet eine Szene aus? Wie grenzt du diese von anderen sozialen Zusammenhängen ab?
BL: Eine Szene ist ein deutlich lockerer Zusammenhalt, als der einer Subkultur. Mit dem Szenekonzept wurde versucht die neuen Vergemeinschaftungsformen der Gegenwart zu fassen, für welche vor allem Unverbindlichkeit, Lebensstilisierung, Ästhetik, Affekt, charakteristisch sind. Und gerade die Zurückweisung der Zumutung irgendeiner großen Idee zu folgen, worauf Subkulturen basieren, ist wesentlich. Der Trend zur Kommerzialisierung ist ebenfalls ein Charakteristikum für Szenen. Der Szenebegriff betont Heterogenität im Gegensatz zum Subkulturkonzept, das Homogenität hervorhebt. Manche Autoren verstehen das Szenekonzept als räumliches Konzept und Szenen als kulturelle Räume. Für Szenen sind Events prägend, welche die Gemeinschaftsidee inszenieren und bestätigen, solche Events sind auch die Festivals, die ich untersuche. Auch deshalb verwende ich den Szenebegriff.
Man könnte in meinem Feld auch von Popkultur sprechen, denn entscheidend für Gemeinschaften der Popkultur ist weiterhin die Verschmelzung von Rezeption und Produktion, ähnlich wie bei Subkulturen. Von Popkultur lässt sich sprechen wenn Popmusik als Grundlage von Identitätsbildungen funktioniert oder für Gruppenformationen, die sich an Stil orientieren (also bestimmte Stile in Film, Musik, Literatur, Theater etc. die zur Popkultur zählen). Die von mir beforschten Gemeinschaften sind Szenen, deren Gruppenidentität wesentlich von Popkultur und Popmusik mitgeprägt werden. Allerdings ist dies nur eines von vielen Interessen, und oft sind die Akteur*innen in mehrere Szenen involviert, was der Szenebegriff ebenso abbildet. Deshalb untersuche ich auch nicht eine Szene, sondern viele Szenen, die sich auf den Festivals überschneiden und zusammenkommen.
Ein Ko-Kurator des donaufestivals meinte diese Gemeinschaft wäre zu weit gestreut, um Szene genannt zu werden, auch weil sie sich lokal jeweils unterschieden. Er hat stattdessen die Begriffe „Netzwerk“ und „Sensibility“ verwendet, letzteres geht auf einen Grundlagentext der Szeneforschung von Will Straw – scenes and sensibilities zurückgeht. Ich würde das jetzt nicht mit Sensibilität übersetzen wollen, sondern eher mit Haltung, Empfänglichkeit oder Vorliebe. Es wurde in der Wissenschaft viel darüber debattiert, was ein adäquater Begriff wäre, der an die Stelle von Subkultur treten können, jedoch gibt es keine Einigung. Subkultur ist aus vielerlei Gründen heute nicht mehr treffend, jedoch bringen die Aktivitäten der Akteur*innen noch immer so etwas wie eine „Kultur“ hervor, weshalb manche Forscher*innen am Subkultur Begriff festhalten. Auch, weil Klassenunterschiede weiterhin eine Rolle spielen, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß wie noch vor 50 Jahren. Für meine Gemeinschaften kann ich sagen, dass Szene oder auch „Sensibility“ weitaus besser passt als Subkultur, eine Art Homogenität ist aber auch hier zu beobachten, da die Mehrheit aus der Mittelschicht kommt und gebildet ist: viele arbeiten im Kreativbereich, sie lesen bestimmte Magazine und gehen auf bestimmte Festivals und Konzerte. Es gilt der Dresscode Black.
GW: Begriff Möglichkeitsraum und „wilde Zone“ – wie fasst du diesen Raum? Was zeichnet einen Möglichkeitsraum aus? Inwiefern sind Festivals sinnliche Räume? Welche Rolle spielen Drogen? Wie produzieren die Veranstalter*innen diese Räume und wie werden diese angeeignet?
BL: Die wilde Zone ist ein Raum der Imagination in der andere Identitäten gefühlt und gelebt werden können. Erfahrungsräume des Utopischen, die eine Erfahrung des Selbst ermöglicht, die jenseits dessen liegt, was in der Alltagswirklichkeit für das Subjekt lebbar ist. Dies ermöglicht Musik an und für sich. Und als physischer Ort kann der Club oder ein Festival als eine solche wilde Zone verstanden werden. Denn es werden für spezifische Musik, spezifische Räume ausgewählt, die in Optik, Atmosphäre oder Klangverhalten, das Davongetragen werden durch Musik verstärken. Hier haben sich in den letzten Jahrzehnten ganz neue Möglichkeiten aufgetan, den Klang selbst zu verräumlichen und auf körperlichen Affekt hin auszurichten, ihn mit Visuals, Licht-/ Dunkelheitseffekten oder Nebel zu verstärken. Diese multisensorischen Erfahrungen erzeugen beispielsweise auch Effekte die Real nicht existieren oder messbar sind: nichthörbare Frequenzen, die den Körper affizieren oder Effekte die durch Licht auf der Netzhaut hervorgerufen werden und „nachhallen“. In Sound-Art oder Medienkunst werden immer gezielter immersive Umgebungen erzeugt, welche ebenfalls auf den Festivals präsentiert werden oder sogar gezielt für diese als Auftragsarbeiten produziert werden. Dort kann man sich teilweise stundelang aufhalten, wenn man möchte und manche Effekte treten erst nach einiger Zeit ein, da reichen fünf Minuten nicht aus.
Mit der Aneignung ist das immer so eine Sache, denn dies sind ja immer nur Angebote und der Effekt hängt auch davon ab, wie sehr man sich darauf einlässt; und Loslassen oder Imagination überhaupt gelernt hat. Auch hier spielt das gemeinsame Erleben oder die Möglichkeit einer temporären Erlebnisgemeinschaft eine Rolle. Dies lässt sich nicht immer planen, aber die Möglichkeit andere Menschen – Bekannte oder Unbekannte – zu treffen ist stets im Format angelegt. Sinnlichkeit spielt in Bezug auf Klang und Musik eine große Rolle, wobei ich sagen würde, dass Ästhetik grundsätzlich mehr im Vordergrund steht als Sinnlichkeit. Denn meist befinden wir uns in Kunst- und Kulturräumen (Theater, Galerien, Museen, Clubs), die gewisse Verhaltensweisen, einen dem Ort angepassten/ angemessenem Habitus, befördern. Häufig geht es um konzentriertes, ernsthaftes Hören im Stehen oder Sitzen, wo sich kaum bewegt wird (shoegazing), dass Emotionen gezeigt werden ist eher selten. Lediglich am Ende von Konzerten zeigen sich diese manchmal in überraschend dynamischen Applaus, Ausrufen oder lautem Schreien. Im Club ist das schon wieder anders, da das Tanzen zu Musik auch einen Effekt hat, der die Musik noch verstärkt und das Loslassen erleichtert.
Alkohol ist natürlich immer vorhanden und wird auch reichlich konsumiert, dennoch findet man auf diesen Festivals eher wenige Menschen, die sich extrem betrinken, denn man ist ja wegen der Musik da. Das heben auch fast alle Akteur*innen hervor, dass dies anders ist als bei anderen Musikfestivals, was alle begrüßen. Es gehört also zum Habitus dieser speziellen Festivals, was nicht heißt, dass gar keine Drogen konsumiert werden. Vielmehr sind einige gemäßigt multitoxisch unterwegs und erproben eine Mischung aus verschiedenen Drogen, die einen möglichst lange fit halten, so dass man möglichst viel vom Programm erleben kann, aber auch gezielt gewünschte körperliche, geistige oder sinnliche Effekte managed, welche die in Raum und Musik angelegen sinnlichen Potenziale steigern. Man muss berücksichtigen, dass dies von fast allen Veranstalter*innen heute versucht wird, denn in der Erlebnis- und Eventgesellschaft sind die Club-Besucher*innen schon einiges gewohnt. Die Organisator*innen sind daher im Zugzwang diese spektakulären Effekte immer weiter zu steigern, was nicht immer möglich ist. Schlussendlich geht es darum Gewohnheiten zu durchbrechen, sei es im Hören, Sehen oder Fühlen – jedoch ist die erste Erfahrung in der Regel die intensivste und prägendste – dies kann nicht beliebig oft wiederholt werden.
GW: Wie bereitest du dich auf die Festivals vor? Wie arbeitest du deine Zeit auf den Festivals auf? Welche Rolle spielt generell die Zeit zwischen den Festivals?
Erst einmal habe ich immer versucht eine Aufgabe zu übernehmen und je nachdem was für eine Aufgabe es ist muss man kürzer oder länger planen. So habe ich zuerst beim CTM ein Praktikum absolviert, dafür muss man sich etwa ein halbes Jahr vorher bewerben. In den Jahren danach war ich dort und beim Atonal Festival als Volunteer tätig. Dafür muss man sich bewerben oder anmelden, in der Regel etwa zwei Monate vorher. Bei der Ars Electronica habe ich als Guide gearbeitet, dafür war eine Bewerbung mehrere Monate im Voraus erforderlich. Vorletztes Jahr habe ich als Koordinatorin bei einem Residency Programm bei CTM gearbeitet, das wurde mir angeboten. Beim Heart of Noise hatte ich einmal als Aufsicht gearbeitet. Guide, Aufsicht und Koordination wurden bezahlt, alles andere war unbezahlte Arbeit (für das Praktikum hatte ich eine Monatskarte bekommen). Generell ist die Situation in Österreich da besser als in Deutschland; dort werden noch Tätigkeiten bezahlt, die in Deutschland schon lange als Volunteer-Tätigkeiten outgesourct worden sind. Bei einigen Festival-Ausgaben war ich als Journalistin akkreditiert und habe im Gegenzug für das Ticket, darüber berichtet (unbezahlt). Bei einigen Festivals muss man für ein renommiertes Medium arbeiten, sonst bekommt man keine Akkreditierung. Also all dies will im Vorfeld geplant sein. Interviews – egal ob für Presse oder Forschung – müssen angefragt und organisiert werden. Im Internet gibt es viele hilfreiche Informationen für Forscher*innen: Selbstdarstellungen und Pressemappen, Presseberichte und Interviews mit den Kurator*innen, teilweise auch eigene Publikationen der Festivals. Ist man erst einmal im Feld drinnen kennt man immer Leute, die schon auf einem Festival waren, das man noch nicht kennt und einem im Vorfeld Informationen geben können. Ist das Festival im Ausland sollte man auch ein bisschen Kenntnisse über Vergangenheit und Gegenwart des Landes mitbringen, sowie zu lokaler Kulturpolitik usw.
Während des Festivals mache ich Fotos und Feldnotizen. Wobei das Schreiben von Feldnotizen bei Festivals schwierig ist, denn oft beginnt es mittags und endet in den frühen Morgenstunden, so dass man weder nachts noch morgens zum Schreiben kommt. Daher habe ich dann nachts oder morgens die Feldnotizen eingesprochen und aufgenommen. Nach dem Festival müssen dann die Feldnotizen und Interviews verschriftlicht werden. Je nachdem was man sonst noch zu tun hat, kann das sehr lange dauern, sich Monate hinziehen. Daher versuche ich bevor ich auf ein Festival fahre die Verschriftlichung und erste Auswertung des letzten Festivals abgeschlossen zu haben, denn dies ist ja Basis der weiteren Verfeinerung und Zuspitzung der Forschung. Dies ist das Ideal, aber das gelingt natürlich nicht immer.
GW: Festivals sind „temporär“ und „ephemer“ – wie gehst du mit der Gleichzeitigkeit im Feld um? Nach welchen Kriterien entscheidest du dich für/gegen die Teilnahme an Programminhalten?
BL: Es haben sich für meine Forschung ja bestimmte zentrale Bereiche herauskristallisiert: Stadt, Prekarität und Gender oder fragen von Inklusion/ Exklusion. Wenn es Bereiche im Programm gibt, die sich gezielt damit auseinandersetzen, dann hat dies für mich Priorität. Das ist selten der Fall, denn Musik organsiert sich nicht nach Themen. Das Diskursprogramm allerdings schon. Beim CTM gab es konkret zu diesen Fragen Programmpunkte. Und es gibt bei CTM Networking Events oder Events, wo sich neue Festivals und Projekte vorstellen. Ansonsten haben neue Orte oder neue Konzepte Priorität. Oder Konzerte, wo ich aufgrund der Musik ein anders zusammengesetztes Publikum erwarte, was dann spannend und zu überprüfen ist. Oft möchte man auch bestimmte Personen treffen und entscheidet danach. Wenn das alles nicht der Fall ist lasse ich mich einfach treiben, schaue mir alles an und lasse mich überraschen, das ist ja der Sinn dieser Festivals.
GW: Wie gehst du mit der Vagheit im Feld um? Wenn sich die Festivals als flüchtig und ephemer der Sprache entziehen, wie lassen sie sich dann in einer Arbeit einfangen?
Sehr gute Frage, aber genau das ist ja die Kunst dabei, die man dann erlernt, wenn es ans Aufschreiben geht. Ambivalenz und Vagheit sind für Szenen ja charakteristisch. Die größte Herausforderung sehe ich darin, die Inhalte die dort präsentiert werden in Worte zu fassen. Das ist sehr schwierig. Es ist aber überaus interessant zu erleben wie sich Festivalbesucher*innen über Inhalte wie Musik und Kunst austauschen. Das spiegelt sich auch in Interviews. Es hilft natürlich, dass ich in der Vergangenheit schon über Musik geschrieben habe, jedoch entfernt man sich davon im akademischen Betrieb. Anregungen findet man ja bei den Festivals selber, die ihr Programm und die Musik der Artists zumindest kurz beschreiben. Und es gibt Journalist*innen die sich auf solche Musik spezialisieren oder auch Pop-Literaten. Diese kann man zitieren oder sich dort Anregungen holen. Und die fertige Arbeit wird dann eine CD enthalten mit Musikstücken, einer Playlist und Interviewschnipseln und Ausschnitten aus Diskursveranstaltungen. Gerne hätte ich auch Fieldrecordings von Festival dabei gehabt, das ist mir aber zu spät eingefallen. Und natürlich viele Fotos.
GW: Thema Nähe/ Distanz in der Forschung: Wie legst du deine Rolle im Feld an? Inwiefern bist du selbst Teil der Szene? Welche Sympathien/ Antipathien tauchen in der Beziehung zum Feld auf?
BL: Das ist schwierig zu beantworten. Das hängt auch davon ab, welche Tätigkeit man ausführt. Als Journalistin habe ich natürlich größere Freiheiten, als wenn ich von einem Festival für etwas bezahlt werde, bin aber auch weniger eingebunden. Optimal wäre meiner Ansicht nach bei jedem Festival als Einstieg erst einmal zu arbeiten, damit man den Feldzugang und grundlegenden Einblicke über die Abläufe bekommt. Auf dieser Basis kann man wesentlich gezielter fragen und beobachten. Als Journalist bin ich den Festivalbesucher*innen viel näher und nehme das Festival auch anders war. Wichtig ist den Feldzugang stetig neu zu etablieren, dazu gehört auch immer wieder zu Festivals zu fahren, denn sie finden das ganze Jahr über statt und man trifft sich dort wieder. So erfährt man von weiteren Events oder auch von Veränderungen oder Problemen. Auch veranstalten viele der Festivals noch andere Events das Jahr über, auch dort sollte man präsent sein. Oder bei Konzerten und Ausstellungen, wo sich die lokale Szene trifft. Dies führt aber dazu, dass man eigentlich ständig im Feld ist, was eine Distanz schwierig macht. Einer meiner Betreuer mahnt mich immer wieder, dass ich raus aus dem Feld muss, wenn ich schreiben will, aber das Feld ist überall, dann muss man aufs Land ziehen oder die Abgeschiedenheit suchen.
Bin ich selber Teil der Szene? Auch schwierig zu beantworten. Anfangs war ich sicherlich nicht Teil der Szene, auch wenn ich Vorkenntnisse über die Musik hatte, was den Zugang erleichterte. Am Anfang habe ich aber sehr stark gespürt, dass ich nicht dazu gehöre, denn ich kannte kaum Leute, Netzwerke oder Orte. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich geändert und inzwischen treffe ich immer jemanden auf einem Festival, den ich schon auf einem anderen Festival getroffen habe. Auch haben sich tatsächlich einige Bekanntschaften und sogar Freundschaften aufgebaut, mit Personen aus dem Feld. Für mich ist eine Feldforschung dann erfolgreich, wenn man Teil des Feldes wird, denn nur so bekommt man ungefiltert die Informationen nach denen man sucht. Dann ist aber auch das Ende nahe.
Sympathien und Antipathien, da weiß ich nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich kann vielleicht sagen, dass ich Momente der Enttäuschung hatte. Dies betrifft vor allem die Festivals, die ich länger und intensiver beforscht habe und wo mir oft vermittelt wurde, dass kein Interesse an dem besteht, was ich tue. Mit dem Atonal Festival war bisher kein Interview mit den Kuratoren möglich, was ja auch ein Desinteresse widerspiegelt. Aber dass das Feld kein Interesse hat sollte man als Normalfall sehen und muss sein Ziel im Auge behalten. Die Wahrnehmung dem/ der Forscher*in verändert sich nur sehr langsam und hat sicher auch mit Vertrauen zu tun. Aber vielleicht auch mit den prekären Umständen vieler Organisator*innen. Zeit ist immer Mangelware und viele sehen keinen unmittelbaren Nutzen darin, sondern nur Zeitaufwand. Das zeigt mir aber auch, dass es durchaus notwendig ist lange dabei zu sein. Das Vertrauensverhältnis ist von zentraler Wichtigkeit und muss immer wieder erneuert werden. Und natürlich gibt es auch die Momente, wo man das Feld satt hat – die Ignoranz, die Konventionen, die Abläufe usw., wo man denkt nun wiederholt sich alles nur noch in unterschiedlichen Nuancen. Das hat man aber bei allem mit dem man sich lange und intensiv beschäftigt, aber möglicherweise ist es auch ein Hinweis darauf, dass das Feld/ die Daten gesättigt sind.
GW: Was ist der Grund für das neue Interesse an Musik – für eine „tiefere“ Auseinandersetzung bzw. Akademisierung? Wie kommt es zu dieser Verbindung/ Verwischung von U- und E-Musik, die man auf den Festivals beobachten kann? Inwiefern findet eine Verbürgerlichung elektronischer Musik statt? Gilt dies auch für die Rezeptionsweisen?
Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass seit Jahrzehnten Einzelpersonen auf diesem Gebiet forschen und es inzwischen genug Grundlagenwerke gibt, die deutlich machen, dass sich eine Auseinandersetzung mit Pop-Musik lohnt, wenn man etwas über Gemeinschaften und Lebenswelten, über die Gesellschaft erfahren möchte. In den USA ist man da schon viel weiter, da kann man eine Professur für den Bereich Rap Musik haben. Auch war England/ UK diesbezüglich ein Vorreiter, zunächst mit der Birmingham School und dann später Anfang der 2000er, wo man in der CCRU versucht hat Club Kultur und Kapitalismus zusammenzudenken. Die Voreingenommenheiten an den Universitäten ändern sich nur sehr langsam, aber sie ändern sich – nämlich dort, wo jemand mit anderen Vorstellungen und Herangehensweisen nachrückt und etwas wagt. Zum anderen ist es auch innerhalb der Gesellschaft inzwischen akzeptiert, wenn man einen eklektischen Musikgeschmack hat. Es gehört sogar zum guten Ton, ist kulturelles Kapital, wenn man über die Oper Bescheid weiß, aber auch über das donaufestival.
Die Überlappung oder Konvergenz von U- Und E-Musik hängt zum einen mit der organischen Verbindung zur Neuen Musik zusammen, also mit den frühen Tapeloop-/ Phograph-Experimenten, Synthesizer- und Computermusik, Musique Concréte, Minimal Music usw. Diese gemeinsame Geschichte der elektronischen Musik wird nun auch von der Club Kultur zunehmend entdeckt, und die Vorliebe für das Experimentieren ist eine Gemeinsamkeit, so dass häufig Kooperationen entstehen und es immer öfter personelle Überschneidungen gibt. Weil Akteur*innen der elektronischen Musik zunehmend auch zu Theaterproduktionen und Konzerthallen der klassischen Musik Zugang haben, also dort miteingebunden werden. Zum anderen hängt dies auch mit Förderstrukturen zusammen. Seitdem der Musikmarkt durch die Digitalisierung eingebrochen ist und damit die Tonträger entwertet wurden, finanzieren sich Musiker*innen fast nur noch über Live-Auftritte; und Festivals übernehmen da eine zentrale Rolle. Durch die gestiegene Akzeptanz von Popmusik, werden nun auch die Fördertöpfe angesucht, die vorher für Neue Musik, Klassik, Kunst-Musik usw. alleine zur Verfügung standen. Neue oder improvisierte Musik mit einzubinden hilft natürlich auch dabei diese Förderungen zu bekommen.
Verbürgerlichung hat immer auch etwas mit Kapital zu tun. Das sieht man sehr gut an der Jazzmusik, wo sich die Alt-68er, die heute ein gutes Auskommen haben sich solche Konzerte und rare Schallplatten leisten können. Der langhaarige Student der in den 1970ern zum Jazzfrühschoppen ging ist heute vielleicht Professor und hört immer noch Jazz, deshalb läuft Jazz auch auf Ö1 oder Deutschlandradio neben klassischer Musik. Der Habitus der Klassik Hörer*innen hat sich dann langsam aber sicher auch auf den Jazz übertragen, darin sehe ich Bourdieus Thesen der feinen Unterschiede bestätigt. Das wird mit gewissen Teilen aus der elektronischen Musik auch so passieren. Man kann beim CTM Festival ein Ensemble, Ambient- oder Noise Künstler*in vom samtigen Theatersitz aus verfolgen, es wird in der Regel aber eher auf dem Fußboden von Clubs gesessen oder eben mit versunkenem Blick gestanden; meist kann dabei geraucht und getrunken werden. Aber eben weil experimentelle Musik oft nicht zum Tanzen ist, sitzt man dann eben, deshalb würde ich noch nicht von Verbürgerlichung sprechen, obwohl dies auch stattfindet. Beide Seiten werden offener dem Anderen und deren Normen gegenüber, nähern sich an. Das hast du gut erkannt.
GW: Welche Rolle spielen die Festivals in der Stadtentwicklung und generell als ökonomischer Faktor? Wie wirtschaften Festivals und in wie fern spielt Prekarität in der Kulturarbeit eine Rolle?
Die Festivals spielen zunehmend eine immer wichtigere Rolle. Wir befinden uns nach wie vor in einer Transformationsphase vom Fordismus/ Post-Fordismus zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft oder zur Wirtschaftsform des Informationalismus wie Castells es nennt. Die Stadt braucht daher neue Einnahmequellen und der Tourismus ist hier ganz weit vorn. Aber auch die elaborierten Kreativarbeiter aus der gutbezahlten Werbe- oder Computerbranche möchte man als neuen Stadtbewohner, und diese legen Wert auf ein ausdifferenziertes kulturelles Angebot, zu dem auch Avantgarde Festivals gehören. Ebenso sind Kunst- und Kulturarbeiter*innen gute Aufwerter*innen für Immobilien.
Die Festivals wirtschaften ganz unterschiedlich. Dies hängt zum einen davon ab, ob sie eine feste Förderung von Stadt, Land oder Bund haben – so wie die ars electronica, das donaufestival oder die transmediale. Da kann ich mich dann eigentlich entspannen. Obwohl auch diese Festivals von Kürzungen betroffen sein können, so wie kürzlich die ars electronica. Dort erhalten die Festangestellten sowieso das geringstmögliche Gehalt nach Tarif und man ist nun durch die Kürzungen gezwungen Geschenke dankend anzunehmen, also Sponsoring-Verträge oder eine bereits finanzierte Ausstellung Anderer zu zeigen, auch wenn sie eigentlich nicht ins Konzept passt.
Bei den Festivals die keine feste Förderung haben sieht es ganz anders aus. Auch spielen lokale Unterschiede eine große Rolle, so ist das Fördersystem in Österreich besser, als das in Deutschland welches aber bei weitem besser ist als die staatliche Förderung in Rumänien, denn dort gibt es keine. Die Finanzierung ist immer ein Patchwork und die einzelnen Elemente variieren von Land zu Land. Das Flickwerk besteht in der Regel aus einer größeren Förderung von Stadt, Bund oder Land, weitere Kosten werden von Botschaften übernommen: Flüge, Gagen oder Unterkünfte. Manchmal gibt es noch Stiftungen oder Organisationen, die einen weiteren Teil übernehmen, für den sie zuständig sind – ein Talk, das Diskursprogramm, eine Ausstellung, eine Radio-Auftragsarbeit oder ein Ensemble Abend. Dann gibt es Sach- und/ oder Geld-Sponsoring. Schließlich werden andere Teile über Getränke- oder Ticketverkauf finanziert. Zunehmend wichtiger werden auch EU-Förderungen. Nachdem das ECAS Projekt beendet war, kam SHAPE als Nachfolgeprojekt, welches die Treffen der Festivalmacher*innen finanziert sowie 50 Künstler*innen jährlich, die auf den Festivals rotieren.
Häufig sind viele unter den beteiligten Festivalmacher*innen und Kulturarbeiter*innen wie Booker*innen, Journalist*innen, Musiker*innen usw. als priviligierte Arme zu kategorisieren. Sie genießen gewisse Privilegien wie freien Eintritt zu Veranstaltungen oder finanzierte Arbeitsreisen. Aber was sie durch ihre Tätigkeiten verdienen ist wenig und unregelmäßig. Die Meisten gehen mehreren Tätigkeiten auf einmal nach. In der Regel ist keine dieser Tätigkeiten sozialversichert, sondern alle werden freiberuflich ausgeübt. Von den nicht fest geförderten Festivalkurator*innen wird kaum einer später eine Rente erhalten, die Aktivist*innen, die in diesen Szenen arbeiten und mit denen ich häufig zu tun hatte, sind ebenso davon betroffen (besonders jene die Ü35 sind). In Rumänien haben die Festivalkurator*innen nur während und unmittelbar vor und nach dem Festival die Möglichkeit sich anzustellen und haben den Rest der Zeit keine Krankenversicherung. Bei den Praktikannt*innen ist die Lage besonders schwierig. Beispielsweise bei CTM bekommen Praktikannt*innen jetzt 150€ im Monat für eine Vier-Tage-Woche (vorher waren es 100€). Volunteering ist sowieso unbezahlt, man bekommt das Festivalticket und Wasser, manchmal Getränke, manchmal eine Mahlzeit. Teilt man den Preis des Festivaltickets durch die Arbeitsstunden so kommt oft ein Stundenlohn von 4€ dabei heraus, der Mindestlohn wird dabei nie zugrunde gelegt. Manche Volunteers müssen wenig für das Ticket arbeiten, bei anderen Festivals viel. Die verlangten Arbeitsstunden variieren von Festival zu Festival. Seit der Einführung des Mindestlohns wird versucht ihn zu umgehen, das geht nun nur noch wenn die Praktikannt*innen aus dem Ausland kommen oder sie ein universitäres Pflichtpraktikum absolvieren müssen. Teilweise waren die Praktikant*innen hoch qualifiziert und bereits über 30. Angeblich gibt es keine Förderungen, die organisatorische Personalkosten abdecken. Die Fahrer und Techniker bekommen allerdings einen für ihre Branche angemessenen Lohn. Aber auch sie arbeiten freiberuflich. Ein komplexes Thema, das sich nicht so kurz erklären lässt, aber ein Aspekt bei diesem Gefälle ist die Feminisierung von Kulturarbeit.
Welche Exklusionsmechanismen kannst du bei den Festivals erkennen? Wer wird wie ausgeschlossen?
Dies ist eine komplexe Frage und ist auch zentral in meiner Arbeit. Ich kann hier aus Zeitgründen, aber nur auf einen Punkt eingehen, den ich unter diversity zusammenfassen möchte und zwar auf Seiten des Lineups. Und zwar deshalb, weil es hier ein Debatte und auch eine Veränderung während meiner Forschung gab. Angestoßen hat diese Debatte im Rahmen der elektronischen Musik die Plattform female:pressure. Sie haben 2013 zum ersten Mal eine Zählung, den sogenannten Facts Survey durchgeführt und zwar über die Anzahl von Männern und Frauen in Bereichen wie Events und Festival, Journalismus oder Labelveröffentlichungen oder Bookingagenturen. Da ich selber Mitglied bin habe ich dies mitverfolgen können. So hat die Zählung 2013 ergeben, dass der ermittelte Durchschnitt bei allen gezählten Festivals international insgesamt 84% Männer und 16% Frauen & Mixed Acts lag. CTM wurde auch erfasst und lag 2013 noch unter diesem Durchschnitt mit 86% Männern und 14% weiblichen und gemischten Acts. Da die elektronische Musik und Club Kultur lange egalitäre Ziele propagiert hat, beispielsweise freie Sexualität und Identität, keine Stars usw. – war der Aufschrei in den Medien groß als die Zahlen veröffentlicht wurden. Und viele internationale Medien haben darüber berichtet. Auch waren bei CTM einige im Team und im weiteren Kreis bei female:pressure, so dass es auch von innen heraus immer öfter thematisiert wurde. Die Diskussion weitete sich dann auf das Thema diversity aus, also wo queere und Trans-Künstler*innen zu finden seien, nicht-westliche Künstler*innen, people of color. Es wurde die Zentrierung auf männliche, weiße Künstler aus westlichen Ländern problematisiert.
CTM steigerte dann in 2014 den Anteil weiblicher Künstler*innen auf etwa 40%, dies ist das Ergebnis einer Debatte, die lange Jahre und auf vielen Ebenen geführt wurde, um dies zu erreichen. Und ich bin froh, dass CTM sich hier verbessert hat! Bei vielen Festivals ist der Anteil immer noch bei 8% Künstlerinnen. Lustig ist, dass CTM diese Veränderung gleich in seinem Sponsoring Profil verwertet hat. Da ist nun als neuer Punkt neben Zielgruppe und Besucherzahlen nun auch Gender hinzugekommen. Im August erscheinen die neuen female:pressure Statistiken für 2015-2017.