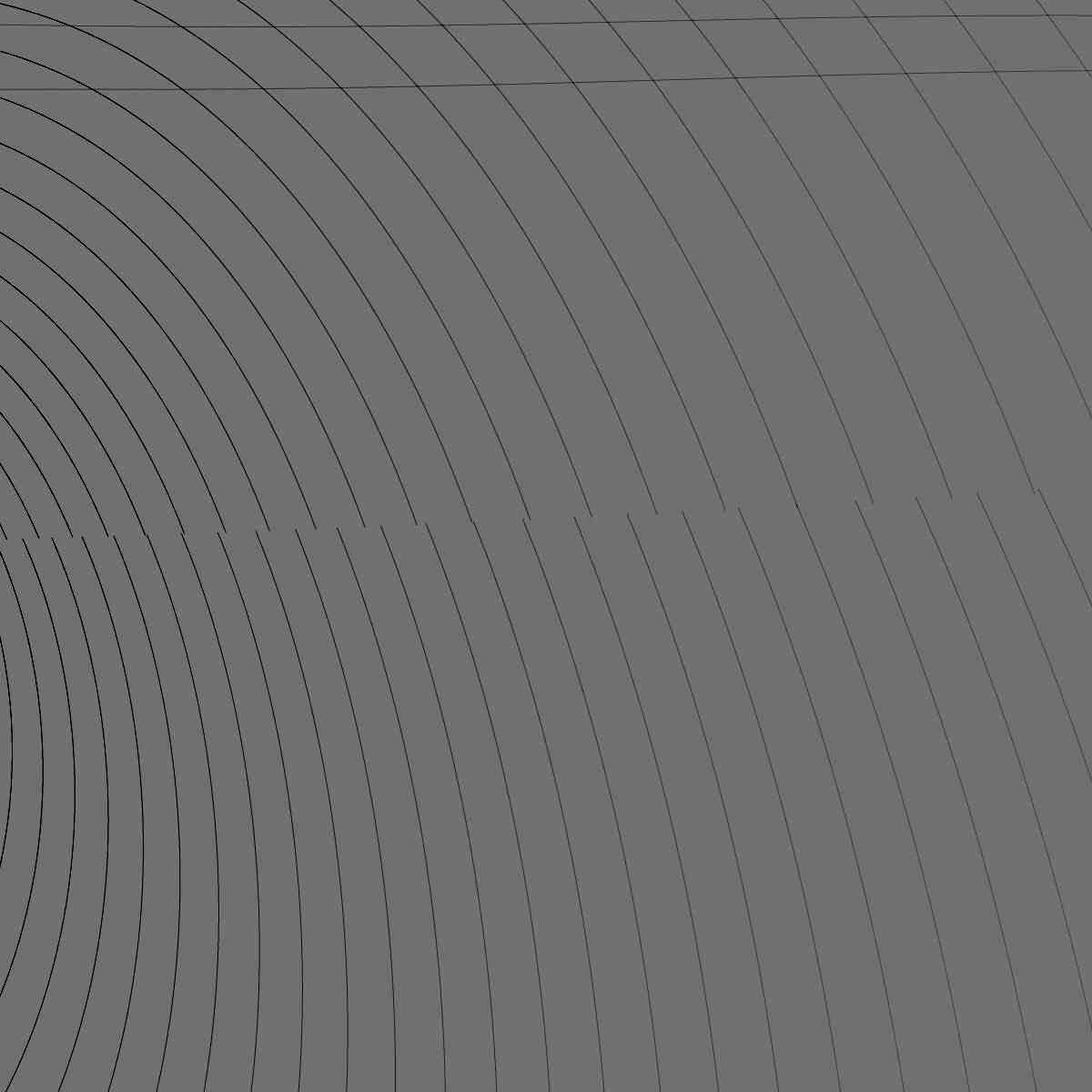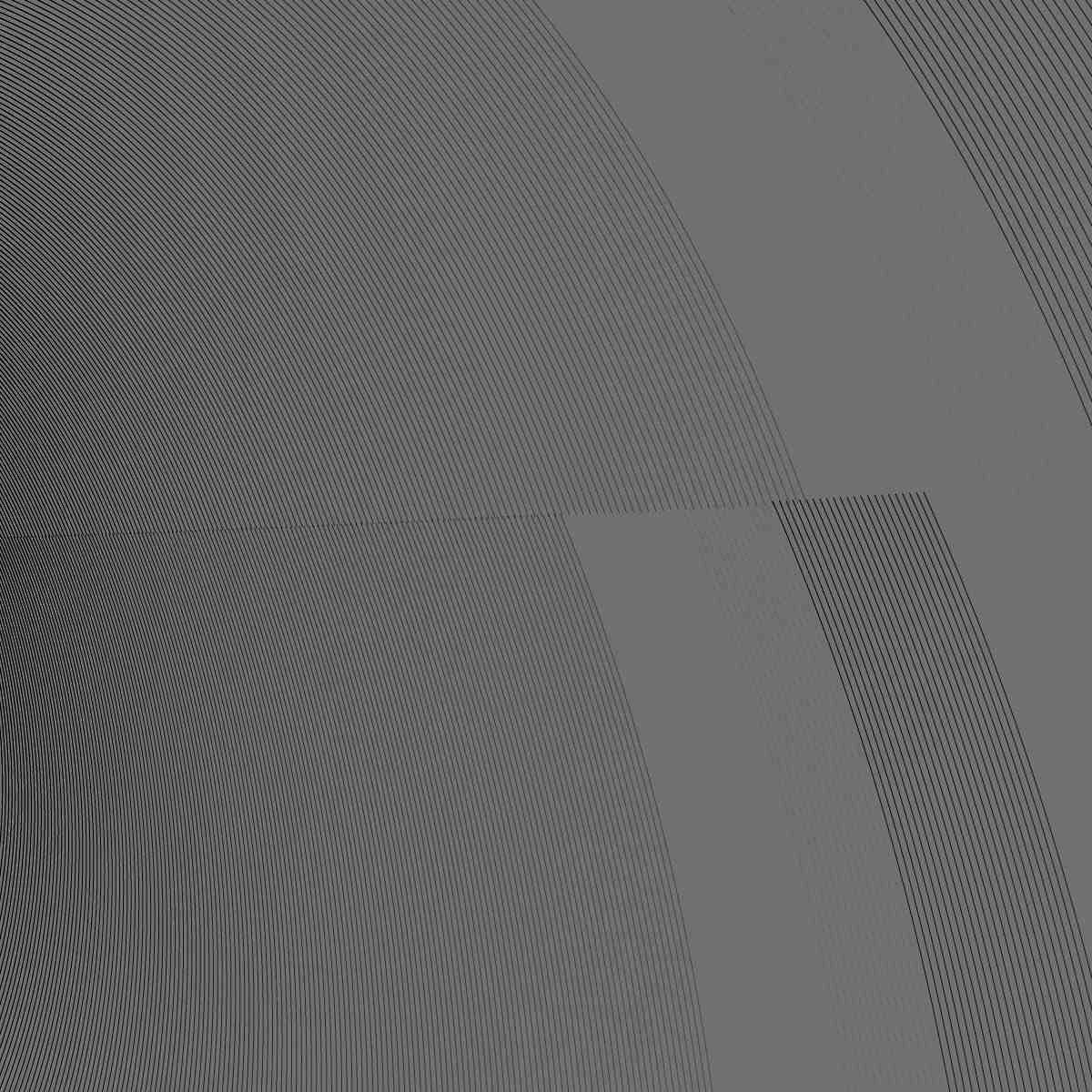Ich freue mich sehr beim Symposium 30 Jahre IG Kultur dabei zu sein. Aufgrund der CoV 19 Maßnahmen wird das Symposium online stattfinden. Mein Input ist im Rahmen des Panel „Armutsfalle Kulturarbeit – Wege aus dem Prekariat“, 19-21h
Meine Präsentation für die IG Kultur kann hier nachgelesen werden.
Titel: Ambivalente Erlebnisräume – Musikfestivals, Cultural Gentrification, Gender Trouble und privilegierte Armut
Ich freue mich Teil dieses Jubiläums zu sein, weil ich die Arbeit der IG Kultur sehr wichtig finde. Ich werde in der nächsten Viertelstunde ein paar Ergebnisse aus meiner Feldforschung auf Musikfestivals zusammenfassen. Für meine Doktorarbeit hatte ich auf Festivals an der Schnittstelle von experimenteller Musik und Medienkunst ethnografisch geforscht. Im Fokus standen zehn Festivals – acht aus Österreich und Deutschland, eins aus Ungarn, und ein weiteres Festival aus Rumänien. Der Forschungszeitraum war von 2013 bis Anfang 2020.
Finanzierung und Arbeitsbedingungen sind sehr unterschiedlich und variieren von Land zu Land. Am besten kenne ich mich in Deutschland aus, weil ich das CTM Festival in Berlin sehr intensiv beforschen konnte. Manche Festivals habe ich nur einmal besucht, und andere fast jedes Jahr. Ich habe auch nicht zu allen Festivals, also den Personen dahinter, das gleiche Vertrauensverhältnis gehabt. Deshalb habe ich auch nicht von allen im gleichen Ausmaß Informationen erhalten. Unter der Vielzahl von Festivals gibt es verbindende Gemeinsamkeiten, aber es überwiegen große Unterschiede auf diversen Ebenen; das gilt auch für die Musikfestivals. Die Festivals, die ich untersucht habe, sind urbane Festivals, die in städtischen Kunst- und Kulturräumen stattfinden. Ich fasse sie unter dem Begriff Transmedia Festivals zusammen. Das soll deutlich machen, dass ich mir beispielsweise Open-Air Festivalformate gar nicht angeschaut habe und dazu auch nichts sagen kann.
Da ich ethnografisch forsche sind neben der üblichen Literatur Recherche Interviews und Feldnotizen, die Grundlage meiner Forschung Und daraus möchte ich euch heute ein paar Schnipsel präsentieren.
Im Titel spreche ich von Ambivalenzen, weil diese Festivals sich in ihrem Bereich als Avantgarde verstehen und Innovation sowie Experiment wird bei den künstlerischen Inhalten großgeschrieben. Im Gegensatz dazu stehen die Organisationsstrukturen und Arbeitsverhältnisse, die oft weniger fortschrittlich sind. In diesem Bereich wird auch kaum experimentiert. Außerdem spreche ich von Arbeit im Titel, weil ich in der kurzen Zeit das breite Spektrum der komplexen Tätigkeiten und Kontexte der Arbeitsverhältnisse nicht so detailliert wie notwendig aufrollen und analysieren kann. Denn mein Fokus lag weder ausschließlich auf den Veranstalter:innen noch auf den Besucher:innen, sondern vor allem auf den Akteur:innen dazwischen. Sie engagieren sich vielseitig in den Szenen, die sich auf diesen Events treffen. Ohne diese Szenen könnten die Festivals nicht existieren. Diese Personen haben immer mehrere Rollen inne – als Musiker:innen, Veranstalter:innen, Labelbetreiber:innen, (Co-)Kurator:innen, Journalist:innen, Expert:innen oder Öffentlichkeitsarbeiter:innen und anderem mehr. Gemeinsam haben diese Arbeiter:innen, dass diese Tätigkeiten mehrheitlich freiberuflich und ohne Absicherungen stattfinden. Es würde mich daher freuen, wenn ihr später in der Fish Bowl zu euren Erfahrungen mit Arbeit auf Festivals berichten könntet.
Ich werde im Folgenden einige Ergebnisse meiner Forschung kurz zusammenfassen, die mit Arbeit in Zusammenhang stehen; und zwar zu den Stichwörtern Cultural Gentrification, Gender Trouble oder privilegierte Armut.
Unter den Festivals gibt es fest geförderte Festivals, die ich als institutionalisiert bezeichne und Festivals der Freien Szene, letztere überwiegen in meinem Sample, obschon viele von ihnen etabliert sind. Die Festivals der Freien Szene müssen Förderungen jedes Jahr neu beantragen und wissen fast nie während der Planung wieviel Geld sie zur Verfügung haben werden. Auch deshalb zeichnet Festivals ein hohes Risiko aus. Diese Unsicherheit versuchen Festivals durch Kooperationen, Netzwerke und EU-Projekte abzufedern. Anträge, Zwischen- und Projektberichte müssen kontinuierlich ausgegeben werden. Aber Kooperationen und Netzwerke bedeuteten neben dem bürokratischen Aufwand in ihrer Summe auch einen enormen Kommunikations- und Zeitaufwand. Deshalb sind Festivalleiter:innen meistens atemlos, sind häufig Getriebene, die nie Zeit haben.
Zu allererst aber die gute Nachricht: Die Arbeitsverhältnisse sind bei den Festivalarbeiter*innen der Freien Szene in Österreich noch am besten. In Deutschland bekommen fast keine der Festivalarbeiter:innen, die jetzt um die 40zig sind später eine Rente, da sie schon lange freiberuflich tätig sind. Und zwar so prekär, dass eine Zusatzversicherung nicht leistbar war und ist. In den postsozialistischen Ländern sieht es noch finsterer aus, weil es für diese Art der Festivals kaum Möglichkeiten der Förderungen gibt, sie sind schlicht nicht vorgesehen. Dort haben die freiberuflichen Festivalarbeiter:innen meistens auch keine Krankenversicherungen, wie Mihaela Vasile eine der wenigen Kuratorinnen im Sample veranschaulicht: „We are not even fully employed at Rokolectiv and the taxes are enormous, almost 100% on top. To get 500 Euro I would have to make 1000 Euro from Rokolectiv. […] There is not much state support and there are no regulations for people who earn under a certain level” (Vasile 2015). Sie führt weiter aus: „I don’t even have a medical insurance and that’s the case with all the freelance cultural workers I know” (ebd.). Vasile versucht deshalb, sich ein paar Wochen oder Monate im Jahr anzumelden und dann alle Arztbesuche zu machen.
Und noch einen Blick ganz nach unten in die Hierarchie der Arbeiter:innen: In Deutschland ist das unbezahlte Volunteering auf diesen Festivals und darüber hinaus schon lange zum Standard geworden. In Österreich sind noch viele Tätigkeiten, die in den Bereich des Volunteerings fallen, bezahlte Jobs. Volunteering bedeutet in der Regel eine gewisse Anzahl von Stunden für ein Festivalticket zu arbeiten. Wie viele Stunden gearbeitet werden müssen legen die Festivals selber fest. Aber kaum ein Festival hatte den Mindeststundenlohn hier zur Grundlage gemacht, rechnet man nach stellt man fest, dass sich meistens ein Stundenlohn zwischen vier und fünf EUR ergibt.
Die Situation der Praktikant*innen war in Deutschland besonders dramatisch. Zwar wurde im Forschungszeitraum der Mindestlohn in Deutschland eingeführt, diesen umgehen aber die meisten Festivals indem sie nur noch Praktikant*innen aus dem Ausland beschäftigen oder solche, die das Praktikum für ihr Studium brauchen. Hier greift die Regel dann nicht. 100 EUR im Monat sind leider keine Seltenheit bei einem Festivalpraktikum. Hakt man hier nach, wird auf die eigene prekäre Lage verwiesen. Die künstlerische Leitung des CTM Festivals sagt 2014 dazu: „Im kulturellen Bereich ist Unterfinanzierung ein stetiger Begleiter und das ist bei uns nicht anders. […] Wenn man mit knappen Ressourcen wirtschaften muss, so wie wir in einem Bereich, der nicht so erträglich und populär ist und von der öffentlichen Kulturförderung noch relativ ignoriert wird, dann ist es einfach so“ (Interview 2014). Katja Lucker, die Leiterin des Berliner Music Boards, das ist eine Einrichtung des Berliner Senats, die Popmusik fördert, sagt 2017, dass solche Formen von Praktika und Volunteering mittlerweile verboten sind, wenn man gefördert wird. Bei kleinen Festivals mit wenig Förderung werde es toleriert, aber große geförderte Festivals müssen sich am Mindestlohn orientieren. Falls es dennoch passiert, wüsste man davon nichts.
Ambivalenz existiert bei den Festivals auf vielen Ebenen, das betrifft beispielsweise eurozentristische Tendenzen im Booking. Oder die Abwesenheit von Frauen in der Kuration und auf den Festivalbühnen, wie das Netzwerk female:pressure mit ihren Statistiken seit 2013 belegt[1]. Das hat auch dazu geführt, dass Quoten für die Lineups bei der Förderung durch das Berliner Music Board eingeführt wurden. Die Reaktionen darauf beschreibt Kaja Lucker, die Leiterin des Music Boards, anschaulich:
„Bei den Festivals schauen wir uns tatsächlich die Lineups an. Das steht dann auch im Vertrag, dass es eine 50/50 Geschlechter-Quote geben muss und wir vergleichen das auch. Weil wir eine eigenständige GmbH sind, können wir eigene Regeln aufstellen und sagen, wir machen das jetzt so. Wer das nicht machen will, der ist bei uns eben falsch. Beim Neujahrsempfang, nach der Einführung der Quote, gab es einen kleinen Eklat, denn wir hatten den Preis für Popkultur unterstützt. Bei der ersten Preisverleihung, da waren dann wieder nur weiße Männer auf der Bühne. Beim Neujahrsempfang hatten wir einen Talk zum Thema. Und der Moderator hatte dann gefragt, warum wir das gefördert haben, wenn da nur weiße Männer waren und dann habe ich öffentlich gesagt, dass wir das so nicht nochmal fördern würden. […] Alle aus der Musik-Branche, Label-Branche und vom Fernsehen waren da… Danach habe ich ewig lange Hass-Emails bekommen und es gab Beschwerden bei anderen Politikern, dass das ja nicht gehen würde und was ich mir einbilden würde. Und bei Meetings haben mich solche Typen vor Wut angeschrien. Ich konnte gar nicht glauben, dass wir im Jahr 2017 sind“ (Interview Lucker 2017).
Ein Best Practice Beispiel kommt von einem in Berlin lebenden DJ und Produzenten. Er hat es zur Bedingung gemacht, wenn er gebucht wird, dass am selben Abend mindestens 50% Frauen und nicht-binäre Artists im Lineup sein müssen. Ein ähnliches Beispiel gibt es von einem Musiker, der um weibliche oder nicht-binäre Fotografinnen bittet. Eine weitere widerständige Praxis für Artists ist es einzufordern, dass Logos von problematischen Sponsoren während des eigenen Auftritts entfernt werden. Man kann das endlos weiter imaginieren und eine Zusage an weitere Kriterien knüpfen, beispielsweise an Fair Pay für alle Beteiligten oder umweltbewusste Festival Praktiken. Hier können gefragte/r Künstler:innen oder Expert:innen ihre Handlungsmacht noch ausweiten.
Eine große Bedrohung für Festivals und Konzertveranstaltungen ist die Gentrifizierung, die auf mehreren Ebenen abläuft. Das betrifft einerseits die Räume in innerstädtischen Gebieten, in denen die Festivals stattfinden. Hierzu nochmals Katja Lucker:
„Vom Thema Musik geht es auch ganz schnell über zum Thema Räume, also wo kann man überhaupt noch diese Art von Kunst und Kultur machen, denn die Stadt hat mit dem Fall der Mauer alles verkauft, alle Liegenschaften verschleudert und jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss man schauen: Wie kann man diesen Raum sichern, so dass Clubs und elektronische Musik auch in Zukunft noch passieren können“ (Interview Lucker 2017).
Das hebt auch eine Berliner Festivalarbeiterin hervor, die außerdem eine Booking-Agentur betreibt und selber kuratiert: „Berlin hat glaube ich immer noch nicht verstanden, dass ihr kulturelles Gut das wichtigste ist, auch weil Berlin eben keine Industrie hat. Musiker und bildende Künstler können sich nur noch gerade eben so ihre Studios leisten und das fängt nun an zu brechen“ (Interview 2014).
Andererseits findet parallel auch eine Gentrifizierung der Inhalte und der Veranstaltungsformate statt. Denn Großkonzerne haben Festivals als Investitionsgeschäft entdeckt. Bisher haben bei den untersuchten Festivals noch keine Konzerne Anteile erworben, aber bei bekannteren Festivals, die ähnliche Genres bedienen, ist es bereits Realität. Und diese Entwicklung beeinflusst auch die Festivals der Freien Szene. Entertainment Konzerne wie Live Nation oder Eventim haben seit den 2000ern Konzertfirmen, Festivals, Kartenportale und Agenturen aufgekauft – und erzeugen so Wachstum durch Übernahmen. Eine Handvoll Konzerne hat inzwischen das internationale Konzertgeschäft übernommen. Deshalb ist der Konzertmarkt, wir sprechen hier von den großen Konzerten, längst segregiert und richtet sich vornehmlich an Besserverdienende und Reiche.
Neue Gewinn-Potenziale ergeben sich vor allem durch die Verknüpfung von Veranstaltungsorganisation und Ticketverkauf. Über das Ticketing, das die Konzerne weitestgehend übernommen haben, das fast nur noch digital abläuft, wird Big Data generiert aus dem die neuen Profite entstehen. Zu den aktuellen Entwicklungen am Festivalmarkt gehört auch, dass Brands nicht mehr nur als Sponsor auf Events in Erscheinung treten, sondern gleich selber das Festival veranstalten. Und so verschärft sich weiter die Konkurrenz am Markt. Sowohl Berthold Seliger, Autor zweier Bücher zum Thema,[2] als auch Festivaldirektor Jan Rohlf vom CTM Festival in Berlin beklagen, dass inzwischen fast alle Künstler:innen kritiklos mitmachen, wenn die Konzerne einladen. Aber bei den Gagen, die Konzerne und Marken zahlen, können die Festivals der Freien Szene nicht mithalten. Das resultiert in einer Beschleunigung und einer Preisspirale nach oben. Jan Rohlf verdeutlicht die Situation:
„Es ist eine Art von Gentrifizierung, dass wir diese zunehmende, aberwitzige Dichte von Musikveranstaltungen haben. […] Das Interesse an Berlin als Ort, der ein bestimmtes Image transportiert ist ja riesig. Das wurde auch bewusst gefördert […]. Und es führt dazu, dass alle hier etwas machen wollen. Das betrifft die Künstler, aber auch Kulturveranstalter aus anderen Ländern, aber auch die Marken […]. Sie übernehmen eben auch Methoden und Formate, die früher außerhalb von so einem Corporate Setting existierten. Man muss das mal ganz klarsehen, wie massiv das mittlerweile ist. Unabhängige Medien machen zu, stattdessen gibt es Kanäle wie Electronic Beats, Red Bull oder Abelton, die für ihre Webseiten oder Magazine Inhalte produzieren. Und sie finanzieren auch Artist Residencies und künstlerische Projekte – von Mercedes bis Intel. Dazu kommen noch die Festivals und Veranstaltungsformate. […] Auch ohne diese Marken gäbe es wahrscheinlich eine Entwicklung hin zu diesem Interesse an hybriden Musikformen, weil alles immer vermischter wird. Aber durch diese Marken wird das massiv beschleunigt“ (Interview 2018).
Um Ideen und Formate zu entwickeln, die mittelfristig eine Differenzierung von Corporate Veranstaltungen ermöglichen bräuchten Festivals erstmal eine finanzielle Absicherung glaubt Rohlf (2018). Und egal, ob Marken oder die Freie Szene Events veranstalten, müsste für Rohlf so oder so sichergestellt werden, dass Besucher:innen oder Künstler:innen „nicht noch anderweitig instrumentalisiert oder ausgebeutet werden“ (2018). Das sei doch ein Wert für den man sich einsetzen sollte. Aber so eine Haltung gäbe es in ihrem Feld noch nicht. Ein wichtiger Punkt den die Festivals deshalb umsetzten können ist ihr Ticketing selber zu machen, anstatt es den Konzernen zu überlassen. Die Kosten und der Zeitaufwand hierfür sollte gleich mit beantragt werden. Ebenso könnten die ökonomischen Aspekte von Musik, faire Praxen oder deren Abwesenheit viel häufiger auf Festivals im Rahmen von Diskurs-Veranstaltungen thematisiert werden. Machtumverteilung und mehr Diversität ließe sich über die Einführung von Co-Kurationen und deren faire Gestaltung (race, age, gender, class) vorantreiben.
Handlungsspielraum gibt es auch bei den Geldgebern und Sponsoren von Festivals. Also staatliche Förderprogramme, EU-Projekte, aber auch Tourismusverbände oder Stiftungen für Festivals. Diese müssten ihre Förderungen an Fair Pay und inklusivere Lineups binden. Und zwar nicht nur für die Künstler:innen, sondern auch für die Mitarbeiter:innen.
Kurz zusammengefasst: Nach meinen Erfahrungen im Kulturfeld und als Forscherin, können einzelne Kulturarbeiter:innen, vor allem weiter unten in der Hierarchie, nur wenig machen. Ich sehe ich Handlungsspielräume bei Förderinstitutionen und Geldgebern, bei den Veranstalter:innen, bei bekannten und etablierten Künstler:innen, Netzwerken und bei den Interessensvertretungen. Die Rolle der IG ist und bleibt deshalb sehr wichtig.
Danke fürs Zuhören!
[1] https://femalepressure.wordpress.com/, siehe Facts 2013-2020. “The female:pressure FACTS survey is a continuous project—undertaken by volunteer members of the female:pressure network—that quantifies the gender distribution of artists performing at electronic music festivals worldwide. FACTS 2020 is the fourth edition of the survey, which was first published in 2013 and updated in 2015 and 2017” (ebenda).
[2] Seliger, Berthold (2015): Das Geschäft mit der Musik. Edition Tiamat, Berlin; (2019): Vom Imperiengeschäft. Edition Tiamat, Berlin.